Kein Lichtlein aufgegangen
BGH fällt Revisionsurteil im Guben-Prozess
Am 9. Oktober, fast zwei Jahre nach der Verkündung des Urteils im so genannten Gubener Hetzjagdprozess, hat der Bundesgerichtshof (BGH) dem Revisionsbegehren zweier Nebenkläger teilweise stattgegeben. Der 5. Strafsenat des BGH hat dabei ein wahrhaft salomonisches Urteil gefällt: Weder ändert sich das Strafmaß des Urteils, noch muss das Verfahren neu aufgerollt werden, noch geht der Öffentlichkeit ein Lichtlein auf über die Rolle der Justiz im gesellschaftlichen Umgang mit rechtsextremer Gewalt.
Wer einen trockenen, formaljuristischen Schlagabtausch erwartet hatte, wurde angenehm überrascht. Zehn der Angeklagten und zwei der Nebenkläger waren gegen die Verurteilung der elf Täter im Hetzjagd-Prozess in Revision gegangen - die eine Seite, weil sie sich einen Freispruch gewünscht hätte, die andere, weil sie die Strafe als lächerlich mild und die Tat als falsch bewertet ansah.
"Stinknormale Jugendliche"
Zur Erinnerung: In der Nacht zum 13. Februar 1999 war eine Gruppe rechtsgerichteter junger Gubener im Alter zwischen 17 und 21 Jahren mitten in der Nacht auf die Jagd nach einem "Dunkelhäutigen" gegangen, der einen ihrer Freunde, den stadtbekannten Nazi-Schläger Ronny P., bei einer Auseinandersetzung vor der Diskothek Danceclub verletzt haben soll. Sie putschten sich mit Alkohol, Musik der Nazi-Band "Landser" und dem Skinhead-Kultfilm "Romper Stomper" auf, luden bei der Verfolgung mit Autos Pflastersteine in die Kofferräume und machten sich auf die Suche nach dem ominösen "Neger", der ihren Kumpel "mit der Machete aufgeschlitzt" habe. Unterwegs beschimpfte und bedrohte die Horde Jungrechter noch unbeteiligte PassantInnen. In der Nähe des Danceclub, im Plattenbaustadtteil Obersprucke, stießen sie auf drei "Ausländer", die am Rande der Bundesstraße zum Asylbewerberheim unterwegs waren. Die Wagen bremsten scharf, die grölende Meute sprang heraus und stürzte sich auf die zu Tode erschrockenen Asylbewerber. Diese liefen panisch zurück in Richtung Disco, doch ihre Verfolger waren wieder in die Autos gesprungen und schnitten ihnen nun abermals den Weg ab. Der 28-jährige Algerier Farid Guendoul und der Sierraleonese Issaka K. rannten los in Richtung Häuserblocks, der dritte Betroffene, der Algerier Khaled B., hastete in Richtung eines Parkplatzes. Auch die Angreifer teilten sich auf und rannten hinter ihren Opfern her. Khaled B. wurde von einem Teil der Meute auf dem Parkplatz niedergeschlagen und getreten, er fiel mit dem Kopf gegen ein Auto und wurde bewusstlos. Die Täter ließen von ihm ab, weil sie dachten, er sei tot - so die Aussage eines Angeklagten. Guendoul und K. erreichten keuchend und in Todesangst die Eingangstür der Hugo-Jentzsch-Straße 14. Guendoul trat, als er den Eingang verschlossen fand, die untere Türscheibe ein und kroch mit K. durch das Loch ins Treppenhaus. Dabei verletzte sich der junge Mann die Beinarterie an der Kniekehle und verblutete in kurzer Zeit.
Nach einem 17-monatigen Prozess vor dem Landgericht in Cottbus, bei dem in über 83 Verhandlungstagen die Umstände des Verbrechens, das zum Teil höchst fragwürdige Verhalten der Polizei sowie das Verhalten der Opfer peinvoll durchgekaut worden war, wurde der an der Hetze beteiligte Teil der Angeklagten wegen der fahrlässigen Tötung von Farid Guendoul und der gefährlichen Körperverletzung von Khaled B. schuldig gesprochen, drei Heranwachsende zu Haftstrafen über zwei Jahren, sechs zu Bewährungsstrafen verurteilt und zwei weitere lediglich verwarnt. In die Kritik geraten waren im Laufe des Verfahrens vor allem die zeitweise über 22 Verteidiger, die mit rund 45 Befangenheitsanträgen und weiteren, zum Teil grotesken Obstruktionsanträgen das Verfahren in die Länge gezogen hatten.
Pädagogischer Effekt verpufft
Bei BeobachterInnen sorgte jedoch weniger die Verurteilung der Angeklagten wegen "Fahrlässigkeit" für Empörung, oder die völlige Ausblendung des neonazistischen Hintergrunds der Täter, sondern vielmehr eine politische Erklärung des Vorsitzenden Richters, Landgerichtspräsident Joachim Dönitz, zum Ende des Verfahrens. Dönitz übte darin Medienschelte und erklärte, das Verfahren sei wegen der medialen Vorverurteilung der Angeklagten als Rechte außerordentlich schwierig geworden. Einmal mehr lieferte er dann eine küchenpsychologische Erklärung für die "Verirrung" der Täter, wonach diesen mit dem Zusammenbruch der DDR die Väter abhanden gekommen seien und die nun in den Skinhead- oder Punker-Gruppen Vaterersatz suchten. Höhepunkt der Stellungnahme war eine Ehrenerklärung für den rechten Szeneanwalt Wolfram Nahrath, bis zu ihrem Verbot 1994 Bundesführer der neonazistischen Wiking-Jugend und noch heute Mitglied des NPD-Parteischiedsgerichts. Ihm bescheinigte Dönitz, dass er sauber gearbeitet und keinerlei Propaganda gemacht habe.
Diese weltfremde und ziemlich dreiste Erklärung, mit der einmal mehr die Täter zu Opfern (in diesem Fall der deutschen Geschichte) erklärt und vor allem die Rolle von Szeneanwälten wie Nahrath und dem ebenfalls beteiligten Carsten Schrank heruntergespielt wurde, war der Schlusspunkt eines Prozesses, der von der Überforderung des Gerichts gekennzeichnet war und in dem nicht nur gegenüber den Opferzeugen und Angehörigen Guendouls eine bedrückend feindselige, bisweilen höhnische Stimmung ausging - von den Verteidigern, den Angeklagten, ihren Angehörigen und deren teilweise in eindeutigem Nazi-Outfit anrückenden Freunden. Die zahlreichen Beweise, dass es sich bei zumindest einem Teil der Täter um astreine Jungnazis handelte, wurden schlicht nicht beachtet oder unter den Tisch gekehrt.
Dass es sich bei dem Prozess um ein Jugendstrafverfahren handelte, brachte mit sich, dass nach der langen Verfahrensdauer gar keine angemessenen Strafen mehr ausgesprochen werden konnten, da der im Jugendstrafrecht geforderte erzieherische Effekt längst verpufft gewesen war. Diese Tatsache spielte nun auch im Revisionsverfahren in Leipzig eine Rolle: Weil eine Neuauflage des Prozesses, also eine höchstrichterliche Zurückverweisung des Verfahrens an einen anderen Landgerichtssenat in Brandenburg, aus dem genannten Grund keine höheren Strafen zur Folge haben dürfe, begnügte sich der BGH damit, die Schuldsprüche zu ändern und das Verfahren so zu beenden. Nicht mehr der fahrlässigen Tötung hätten sich die Angeklagten schuldig gemacht, befand das Gericht, sondern der versuchten Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter und vollendeter gefährlicher Körperverletzung. Weitere Straftaten wie Beleidigung, Nötigung, und Volksverhetzung blieben von der Veränderung unberührt. Der BGH gab damit den Einwänden der NebenklagevertreterInnen recht, die in Bezug auf den Betroffenen Issaka K. angemerkt hatten, dass er im Urteil mit keiner Silbe erwähnt werde, obwohl er hochgradig traumatisiert worden sei. Hier ergänzte das Gericht den Schuldspruch um eine "versuchte gefährliche Körperverletzung" bei allen Angeklagten. Neu ist auch die Konstruktion der "versuchten Körperverletzung mit Todesfolge", die der Tatsache Rechnung tragen soll, dass keiner der Angeklagten tatsächlich Hand an Farid Guendoul gelegt hatte: Er war an Verletzungen gestorben, die er sich selbst zugezogen hatte. Auf diese Weise wird nun den Tätern eine Verantwortung für den gesamten Handlungszusammenhang zugewiesen, in dem Farid in Todesangst die - wie das Gericht meinte - "nachvollziehbare und sinnvolle" Selbstgefährdung durch das Eintreten der Scheibe riskiert habe, um der Gefahr zu entkommen. Auch die Verfolger, die im Auto zurückgeblieben waren, macht das Gericht im Tatzusammenhang des ganzen Abends mitverantwortlich. "Wir haben heute Rechtsgeschichte geschrieben", freuten sich denn auch die Berliner Rechtsanwältinnen Christina Clemm, Regina Goetz und Theda Giencke. Für die Betroffenen und die Hinterbliebenen von Farid Guendoul ist das Umetikettieren des Schuldspruchs eine folgenlose juristische Spitzfindigkeit und akademisch geblieben. Sie zeigten sich am Rande des Geschehens bedrückt und enttäuscht. Einen Teilerfolg erzielte die Nebenklage mit der Neuinterpretation der Tat für die Nebenkläger Issaka K. und den Bruder des Getöteten, Malik Guendoul.
"Rechtsgeschichte geschrieben"
Lange Gesichter zeigten die neun erschienenen Verteidiger der Angeklagten, als der BGH-Strafsenat ihre sämtlichen Verfahrensrügen für unzulässig erklärte oder zurückwies. Davon abgesehen, nutzten sie das Revisionsverfahren dazu, ihre verdrehten Tatversionen zu rekapitulieren, denen zufolge ihre Mandanten in jener verhängnisvollen Nacht kein Wässerchen getrübt hätten und zum Teil gar freizusprechen gewesen seien. Insbesondere der Anwalt des Angeklagten Alexander B., der zur Zeit wegen eines weiteren Gewaltdelikts in U-Haft sitzt, zeichnete von seinem Mandanten das Bild eines "stinknormalen Jugendlichen", dessen Unbekümmertheit ihn in eine Situation gebracht habe, die er sehr bereue und bedauere. Tatsache ist, dass Alexander B. einer der wenigen zur Tatzeit tatsächlich in NPD-Nähe agierenden Täter war und die Verfolgungsjagd durch forsche Reden und Handy-Mobilisierung gemanagt hatte. Nahrath, der seinen Mandanten, den Neonazi Steffen H., in der rechten Szene zu so etwas wie einem "Helden des Nationalen Widerstands" aufgewertet hatte, bestand darauf, dass die beiden Algerier doch gar nicht gemeint gewesen seien, sondern nur der Schwarze Issaka K. Dass dieser "error in persona" für die Verfolgten wohl vollkommen gleichgültig gewesen sein dürfte, scheint Nahrath nicht einsichtig.
Friedrich C. Burschel



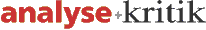 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 466 / 18.10.2002
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 466 / 18.10.2002
