Theorie: gut, Revolte: besser, Theorie der Revolte: am besten
"Konjunkturen des Rassismus" gegengelesen
Man beschwört die politische Mitte und verurteilt die Extreme. Haider, Schill, Fini und Konsorten sind keine "Extremisten", sondern "Populisten". Der rot-grünen Modernisierungsfront geht es in Sachen Einwanderung um "Integration". Daneben wächst die Zahl der Illegalisierten, und der Rassismus in den Institutionen wie auf der Straße wird, obwohl die "multikulturelle Gesellschaft" beschworen wird, nicht weniger. (Anti-)Rassismustheorien im herrschenden sozialwissenschaftlichen Diskurs tun angesichts dessen vor allem eins: langweilen.
Für eine kritische antirassistische Theorie, die praxiswirksam sein will, besteht also Erklärungs- wie Handlungsbedarf. Erklären sollte sie können, ob, und wenn ja, wie die Mitte, der Rechtspopulismus und die verschiedenen Krisen antirassistischer Theorie und Praxis zusammenhängen. Handeln sollte sie, indem sie brauchbare Gegenentwürfe liefert, die politische Prozesse und Herrschaftsstrukturen, aber auch die möglichen Stagnationseffekte, die antirassistische Theorie selbst produziert, reflektiert - und zugleich über den bloßen Akt der Reflexion hinauskommen.
Nicht weniger haben sich Alex Demirovic und Manuela Bojadzijev in dem von ihnen herausgegebenen Band vorgenommen. Ein unmögliches Unterfangen? Sicher: Wer fertige Antworten sucht, wird enttäuscht werden; nicht aber, wer Lust darauf hat, lesenderweise an den Prozessen kritischer Theorieproduktion in progress teilzunehmen.
Zwanzig AutorInnen schreiben in fünfzehn Beiträgen über Rechtspopulismus, Rassismus und Antirassismus. Anlass war eine Tagung im Frankfurter Institut für Sozialforschung im April 2001, auf der man über "Rechtspopulismus und die Wirkungen der kritischen Rassismusforschung" diskutierte. Dieser Titel weist auf das theoriepolitische Programm der HerausgeberInnen: Rechtspopulismus und Rassismus werden nicht als abschließbare Phänomene betrachtet, die unter der Lupe sozialwissenschaftlicher Theoriebildung besser oder schlechter "erkannt" werden können. Sondern Theorie soll aktiv eingreifen in das Verhältnis von Rassismus und Antirassismus, das nicht einfach als eins von falscher Ideologie und richtiger Theorie, sondern als soziales Kräfteverhältnis verstanden wird.
Rechtspopulismus am rechten Rand und in der Mitte
Zunächst geht es also um "Rechtspopulismus" - ein Verlegenheits- und ein problematischer Begriff, der die ideologische Beschwörung der gesellschaftlichen Mitte immer schon mittransportiert: Andererseits ist er ohne diskursanalytisch und historisch unhaltbare Verkürzungen nicht durch "Extremismus" oder gar "Faschismus" ersetzbar. Was diesem Begriff gleichwohl gelingt, ist, eine Plattheit der Ideologie vorzugeben, die ein erstaunliches Potenzial des Rechtspopulismus verdeckt: Paradoxien und antagonistische Interessen auszuhalten, zu pflegen und zu seinen Gunsten zu bündeln. Autoritarismus und Parteienkritik, Neoliberalismus und Konservativismus, starker und schwacher Staat - alles hat einen systematischen Platz innerhalb der rechtspopulistischen Logik, die, auch das zeigen die Beiträge deutlich, sich eben nicht auf Berlusconi oder Schill beschränken lässt, sondern längst die Diskurse und Programmatiken der "Mitte" strukturiert, wie zuletzt Jürgen Möllemann überzeugend vorgeführt hat.
Wurde "die Mitte" zur Zeit der Französischen Revolution und noch in der Weimarer Republik vor allem negativ gleichgesetzt mit "faulem Kompromiss" und "Identitätsmangel", so ist sie inzwischen in Deutschland gänzlich umgewertet: Die "Mitte" ist so inhaltsleer wie hochbedeutsam, wie Jürgen Link an diversen wohl bekannten Binsenwahrheiten zeigt: Nur die Mitte ist regierungsfähig, Weimar ist an der schwachen Mitte und den starken Extremen zugrundegegangen, Extreme von rechts und links schaukeln sich gegenseitig hoch, laufen auf eins hinaus etc. Diese Verschiebung kann Link mit seiner Theorie des "Normalismus" erklären, die er hier auf das Phänomen Rechtspopulismus anwendet. Die systematische gesellschaftliche Produktion von Normalität, so Link, ermittelt zwanghaft in unterschiedlichen Bereichen den angestrebten Normalwert: "so eine mittlere und damit normale Koitusfrequenz zwischen den ,Athleten` und den ,Asketen`, so ein mittlerer und damit normaler Lebensstandard zwischen den ,Krösussen` und den ,Lazarussen` ..." etc. (S. 200) Was dem Begriff Rechtspopulismus folglich gelingt, ist die Integration ins Normalspektrum und damit in die Koalitionsfähigkeit.
So normalisiert sich - schon lange - auch der Rassismus. Keineswegs dem "rechten Rand" vorbehalten, wächst auch auf Seiten des sozialdemokratischen Neoliberalismus das Verständnis für die "Sorge der Menschen" um Kriminalität und Zuwanderung. Ursula Birsl geht davon aus, dass in Deutschland auf Bundesebene noch keine Chance für rechtspopulistische Parteien besteht, da eben die so genannte politische Mitte genügend "rechtspopulistische Unterströmungen" aufweist (S. 31), die diesen Entfaltungsraum verhindern. Damit hält Birsl aber implizit die u.a. von Konservativen vertretene These aufrecht, sie müssten rechtspopulistische Strömungen aufgreifen, um sie unschädlich zu machen. Demgegenüber argumentiert die Österreicherin Eva Kreisky, dass Neoliberalismus und Rechtspopulismus einander strategisch ergänzen. Ihre ideologischen Affinitäten seien bislang z.B. in der österreichischen Diskussion um Haider zu sehr vernachlässigt worden. Rechtspopulismus ist für Kreisky der politische Arm des Neoliberalismus, der die Tradition des modernisierten Rechtsradikalismus fortsetzt: "Was Augusto Pinochet, Margret Thatcher, Ronald Reagan & Co in den siebziger/achtziger Jahren in Gang gesetzt hatten, wird nunmehr in Europa auf einem neuen historischen Niveau praktiziert." (S. 80)
Nicht nur der Rechtspopulismus hat sich erneuert, auch Migrationspolitiken und Rassismen verändern sich. Einwanderung wird inzwischen nicht mehr grundsätzlich bekämpft, sondern in Kombination mit scharfen Kontrollmechanismen "gesteuert". Die aufgeklärte Akzeptanz von Zuwanderung koppelt der rot-grüne Integrationsdiskurs konsequent an ein entschiedenes Vorgehen gegen illegalisierte Immigration. Dabei gibt, wie Margarete und Siegfried Jäger zeigen, der Begriff "Zuwanderung" bereits die Richtung vor: "Sie" kommen auf uns zu, und nicht zu uns herein; nicht um "Ankunft", sondern um "Zumutung" geht es also.
Rassismus in Institutionen
und Alltag
Das, was scheinbar "zugemutet" wird, ist, glaubt man dem herrschenden Diskurs, immer noch die andere "kulturelle Identität". Etienne Balibar zeigt, wie es dem Begriff der kulturellen Identität letztlich immer wieder misslingt, die Unbestimmtheit des Ortes, der "Kultur" genannt wird, zu überwinden. Was der Begriff behauptet: Wer eine Kultur hat, der hat idealerweise auch eine "Muttersprache" und damit ein "sprachliches Universum", dessen Beherrschung zugleich Beherrschung der Kultur verspricht. Die Vielstimmigkeit der Muttersprachen, so Balibar, wird dabei gewaltsam ausgeblendet: Niemand würde überhaupt sprechen, wenn er nur reines Französisch, Englisch oder Arabisch spräche. (S. 147) Balibar vergleicht seine Überlegungen zur kulturellen Differenz mit der Geschlechterdifferenz; keine schlechte Idee an sich, bloß auch nicht sonderlich neu. Die Regalmeter feministischer Literatur zu diesem Thema kennt Balibar vielleicht nicht, denn er prophezeit, dass gerade Frauen es schaffen könnten "sich in einer Weise zwischen den Kulturen zu bewegen, die es für Männer nicht gibt: es müsste ihnen nur gelingen, das Verbot zu überwinden, untereinander ohne Autorisierung zu kommunizieren". (S. 154) Offenbar ahnt er nicht, dass Frauen schon seit Jahrzehnten und sogar ohne (männliche?) "Autorisierung" untereinander kommunizieren, auch über so genannte "kulturelle" Grenzen hinweg; dass sie die Erfahrung der Geschlechterdifferenz gleichwohl nicht zur transkulturellen Avantgarde adeln konnte, da sie in nichts weniger fiktiv ist als die kulturelle Differenz selbst.
Dass "Aufklärung auf rassistische Muster geringen Einfluss" (S. 20) hat, ist eine der einleitenden Thesen der HerausgeberInnen. Was heißt das für kritische Rassismustheorie? Hat möglicherweise auch der linke skandalisierende Aufklärungsgestus den paradoxen Effekt, der Rechten immer wieder genau jene Macht zuzuschreiben, die sie in Anspruch nehmen will? Zur Stagnation der kritischen Rassismustheorie schreibt Jost Müller. Diese drücke sich u.a. in der Hegemonie des Begriffs des "Ethnischen" in den Sozialwissenschaften aus. Von kritischer Theorie sei eigentlich zu erwarten, dass sie die Verwendungsweisen dieses Begriffs denunziere. Außerdem kommt es ihm darauf an, den Begriff "alltäglicher Rassismus" mit einer Theorie und Kritik des Alltagslebens zu verknüpfen, die nicht von einer einfachen Idee von "Entfremdung" ausgeht, sondern Alltag begreift als Ort der Artikulation und Umsetzung verschiedener sozialer Machtverhältnisse, die gerade nicht auf einen Begriff zu bringen sind. Denn die auch in linken Konzepten gern genommene Ineinssetzung von Antikommunismus, Sexismus, Normalismus und Rassismus hat, so Müller, einen skurrilen Effekt: "Da vermeintlich alles bereits erkannt ist, ist gar nichts mehr erkennbar." (S. 237)
Vassilis Tsianos und Serhat Karakayali zeigen einen roten Faden, der sich vom ersten GastarbeiterInnen-Abkommen 1955 über das sogenannte "Inländerprimat", den Anwerbestopp 1973 bis zur systematischen Illegalisierung von MigrantInnen im Rahmen gegenwärtiger "Zuwanderungspolitik" zieht: Ökonomische Kalkulationen des (schlecht bezahlten) Arbeitskräftebedarfs lassen sich besonders effektiv mit den Instrumenten des Ausländerrechts umsetzen. Doch zeigt sich eben auch, dass das Kalkül nur bedingt aufgeht. Den Anwerbestopp von 1973 konnten MigrantInnen effektiv durch das Mittel der "Familienzusammenführung" unterlaufen. So erhöhte sich, quer zu den von Staatsseite beabsichtigten Effekten, die Zahl der Migrantinnen und Migranten nach 1973 noch. Eben: Autonomie der Migration.
Da liegt auch der Ansatzpunkt für Manuela Bojadzijev. Sie beschreibt die Geschichte des Zusammenhangs zwischen Antirassismus und Klassenkampf in der BRD; ein Zusammenhang, der in antirassistischer Theorie und Praxis oft schlicht unsichtbar bleibt. Dabei ist es, so Bojadzijev, für eine antirassistische Arbeit unabdingbar, eine Vorstellung davon zu haben, welche historischen Auseinandersetzungen es bereits gegeben hat. (S. 271) Aber damit ist gerade keine Rückkehr zu schlicht-kommunistischen Vereinheitlichungsformeln gemeint, wie z.B. "Deutsche und ausländische Arbeiter: Ein Gegner - Ein Kampf". Bojadzijevs Rückblick auf die migrantischen Kämpfe der siebziger Jahre verdeutlicht vielmehr, dass die von der Linken damals postulierte "Einheit der Arbeiterklasse" die Entrechtung der MigrantInnen systematisch ausblendete. Gleichwohl kam es zeitweise zu erfolgreicher Zusammenarbeit, zum Beispiel beim Arbeitsstreik in den Ford-Werken in Köln-Niel im Jahr 1973. Doch schließlich gelang Arbeitgebern und Gewerkschaften auch in Köln-Niel die Politik der Spaltung. Nicht zufällig auch ist bis heute weitgehend unbekannt, dass die Proteste gegen überhöhte Mieten und miserable Wohnbedingungen im Frankfurter Westend zuerst von MigrantInnen ausgingen. Nicht besser in dieser Hinsicht die entgegengesetzte Mythenbildung, in der MigrantInnen zur Avantgarde der Arbeiterkämpfe erklärt werden und die problematische Stelle des revolutionären Subjektes besetzen sollen.
Antirassismus und Autonomie der Migration
Dass das Establishment nun anerkennt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ist nicht zuletzt eine Reaktion auf eben diese Autonomie, stellen Tsianos und Karakayali fest. Und auch Bojadzijev formuliert als zentrale These: "Integration und Abschottung wurden zu Pfeilern der Ausländerpolitik ausgebaut: Sie sind als Reaktion zum einen auf die ,Autonomie der Migration` und zum anderen auf die ,Kämpfe der Migration` zu verstehen." (S. 280) Diese Sicht wird auch in deutschen antirassistischen Kreisen sicherlich nicht jedem/r wie Sahne runter gehen, erfordert sie doch eine radikale Absage an jegliche Form von karitativem Paternalismus. Statt dessen rückt die Geschichte der Migration, die eine Geschichte von sozialen Kämpfen ist, in den Blick.
Was dieses Buch zeigt: Wie Theorie zum aktiven Einsatz in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen werden kann. Und dies ist, im besten Sinne, notwendige "Aufklärung".
Stefanie Graefe
Alex Demirovic, Manuela Bojadzijev (Hrsg.): Konjunkturen des Rassismus. Westfälisches Dampfboot, Münster 2002



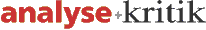 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 467 / 22.11.2002
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 467 / 22.11.2002
