Noch kein zweites Vietnam
Die Antikriegsbewegung in den USA mobilisiert Hunderttausende
An die Teilnehmerzahlen in Florenz reichten die Antikriegs-Demos Ende Oktober in Washington und San Francisco nicht heran. Aber auch dort übertrafen sie alle Erwartungen: Rund eine Viertelmillion Menschen demonstrierten am 26. Oktober in den beiden US-Großstädten gegen einen möglichen Irak-Krieg. Schon drei Wochen zuvor hatten sich landesweit mehrere Zehntausend an einem Protesttag unter dem Motto "Not in our name" beteiligt. Im ganzen Land entstehen neue Friedensgruppen, werden Vorträge, Mahnwachen und Demos veranstaltet.
Vor gut einem Jahr, zu Beginn des US-Kriegs gegen Afghanistan, hatte es in den USA nur vereinzelte kleine Protestaktionen gegeben, die größte (mit einigen tausend Leuten) Ende September 2001 im Rahmen einer Demo gegen IWF und Weltbank in Washington. Doch angesichts der patriotischen Welle nach dem 11. September fanden diese Aktionen nur wenig öffentliche Resonanz, und nach der unerwartet schnellen Vertreibung der Taliban aus Kabul war von dieser Mini-"Bewegung" bald nichts mehr zu hören. Auch der Nato-Krieg gegen Serbien 1999 stieß in den USA nur auf wenig öffentlichen Protest.
Heute drängen sich eher Parallelen zum Herbst 1990 auf, als die USA nach dem irakischen Einmarsch in Kuwait mit ihren Kriegsvorbereitungen begannen. Auch damals waren die US-Eliten geteilter Meinung über das beste Vorgehen, und im Kongress erhielt Präsident George Bush Senior nur knappe Mehrheiten für einen Angriff. Kurz nach Kriegsbeginn Mitte Januar 1991 mobilisierte die Antikriegsbewegung mehrere zehntausend Menschen zu zwei miteinander konkurrierenden Demos in Washington im Abstand von einer Woche (Knackpunkt war die Frage, ob man die Annexion Kuwaits durch den Irak verurteilen sollte oder nicht) - und fiel im Februar 1991 angesichts der militärischen Erfolge des US-Militärs schnell in sich zusammen.
Im Unterschied zu 1991 kann die Antikriegsbewegung diesmal bereits vor Beginn der Kampfhandlungen Massen mobilisieren. Der erste öffentliche Ausdruck war die "Not in our name"-Initiative im vergangenen Juni. Diesen wortgewaltigen, fast poetischen Aufruf haben bisher mehrere tausend US-AmerikanerInnen unterschrieben, darunter etliche prominente Kunstschaffende und WissenschaftlerInnen. Die Bewegung ist keineswegs so grauhaarig und desorientiert, wie sie kürzlich im Spiegel porträtiert wurde ("Das letzte Aufgebot", Nr. 48/02). So demonstrierten in Manhattan kürzlich mehrere tausend SchülerInnen. Auch an den Universitäten gibt es so viele Antikriegs-Aktivitäten wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die nächsten landesweit koordinierten Proteste sind für Mitte Januar (18.-20. Januar, Martin-Luther-Kings-Geburtstag) und für den 15. Februar geplant.
Dass die Interessen der Erdölkonzerne der eigentliche Kriegsgrund seien, diese Annahme ist in der Bewegung praktisch unumstritten ("No blood for oil"). Zudem kritisieren viele eine neue Weltordnung, in der die US-Regierung ungehindert ihre Interessen durchsetzen kann. Die (in der Regel völlig unkritische) Solidarität mit der palästinensischen Nationalbewegung gilt als selbstverständlich - die US-Linke ist schon lange stark antizionistisch geprägt. Sympathisch ist dagegen die Selbstverständlichkeit, mit der die Friedensbewegung nicht nur gegen Kriegspläne, sondern auch gegen die innenpolitischen Verschärfungen seit dem 11. September 2001 protestiert - seien es neue Überwachungsgesetze oder Repressalien gegen arabisch-stämmige Immigranten.
Zögerliche Gewerkschaften
Umstritten ist, ob UN-Waffeninspektionen und Sanktionen akzeptabel (oder gar wünschenswert) sind. Die Mehrheit der Antikriegs-Aktiven dürfte dies befürworten. Viele KriegsgegnerInnen setzen große Hoffnungen auf die Demokratische Partei - wider alle historischen Erfahrungen. Zwar stimmte Mitte Oktober etwa die Hälfte der demokratischen Abgeordneten für die Irak-Resolution des US-Präsidenten, aber eine echte Opposition ist aus dieser Ecke nicht zu erwarten. Zudem hoffen viele US-Linke auf die westeuropäischen Regierungen. Dass Schröder und andere nicht aus "Vernunft" oder gar aus "Friedensliebe" handeln (sondern eben gemäß ihrer eigenen Interessen im Rahmen der inner-imperialistischen Konkurrenz), will man nicht so richtig wahrhaben.
Auffallend wenig präsent sind bisher die US-Gewerkschaften, die ansonsten in vielen sozialen Bewegungen eine wichtige Rolle spielen. Bisher haben nur einzelne Ortsverbände ausdrücklich gegen einen US-Angriff auf den Irak Stellung bezogen. Eine gewisse Ausnahme bildet New York City, wo es ein aktives gewerkschaftliches Antikriegs-Komitee gibt und wo die Krankenhausgewerkschaft (200.000 Mitglieder) im Oktober eine ganzseitige Anzeige in der New York Times veröffentlichte, in der sie für eine "friedliche Lösung im Rahmen der UN" und gegen die neue Bush-Doktrin des "Präventivkrieges" eintrat.
Selbst John Sweeney, Vorsitzender des gewerkschaftlichen Dachverbandes AFL-CIO, ging im Oktober auf vorsichtige Distanz zur Regierungspolitik. Krieg dürfe "nur die letzte Option" sein, schrieb er in einem offenen Brief an den US-Kongress. Allerdings habe "Amerika sicherlich das Recht, auch im Alleingang zu handeln, wenn wir unsere nationalen Interessen verteidigen müssen". Nicht gerade eine Antikriegs-Position, aber doch ein deutlicher Unterschied zur Situation vor einem Jahr, als der AFL-CIO den "Krieg gegen den Terror" (inklusive des Angriffs auf Afghanistan) noch ausdrücklich unterstützte - und ein glatter Gegensatz zu den 1960er-Jahren, als die meisten Gewerkschaften den US-Krieg in Vietnam bis zum bitteren Ende verteidigten (bisweilen auch mit handfesten Übergriffen auf KriegsgegnerInnen).
Das organisatorische Rückgrat der beiden bisherigen großen Antikriegs-Mobilisierungen bildeten zwei kleine kommunistische Kaderparteien. Der Aufruf "Not in our name" wurde von der maoistischen Revolutionary Communist Party (RCP) initiiert, deren deutscher Ableger die vor allem in Berlin berüchtigte RIM ist. Dank einer geschickten Bündnispolitik - und angesichts des sonstigen politischen Vakuums auf der Linken - gelang der RCP (die selbst kaum öffentlich auftrat) eine beeindruckende Mobilisierung, die sich aber wahrscheinlich so nicht wiederholen lässt.
Etwas dauerhafter angelegt ist die "International Answer Coalition" (Answer = "Act Now to Stop War and End Racism"), die kurz nach dem 11. September 2001 entstand und die die beiden Großdemos am 26. Oktober organisierte. "Answer" teilt sich Büro, Personal und Programm mit der stalinistischen Workers World Party (WWP). Deren Gründer verteidigten 1956 den sowjetischen Einmarsch in Ungarn und verließen deswegen ihre Mutterpartei, die (damals noch trotzkistische) Socialist Workers Party. 1989 bejubelte die Gruppe die blutige Niederschlagung der "Konterrevolution" auf dem Tienanmen-Platz in Peking; in den 90er-Jahren hielt man es mit Slobodan Milosevic und mit Nordkorea. Um so flexibler (bzw. opportunistischer) ist die WWP in der Innenpolitik, wo sie für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen ebenso eintritt, wie sie mit den afro-amerikanischen Antisemiten der "Nation of Islam" und deren Abspaltungen gemeinsame Sache macht.
Kommunistische Kader
Eine weitere Tarnorganisation der WWP (selbe Adresse) ist das "International Action Center" (IAC), das bereits seit etwa zehn Jahren aktiv ist. IAC-Sprecher John Catalinotti tritt gelegentlich auch bei deutschen FriedensfreundInnen auf (unter anderem in der Junge-Welt-Beilage vom 4. Dezember). Das wohl bekannteste Aushängeschild dieser Briefkastenfirma ist Ramsey Clark, der 1967/68 für kurze Zeit US-Justizminister war und seither einige politische Wandlungen durchgemacht hat (u.a. als Verteidiger des Rechtsradikalen Lyndon LaRouche und von Slobodan Milosevic). Die Rolle von RCP und WWP ist kein Geheimnis. Linksliberale Stimmen wie der Kolumnist David Corn von The Nation versuchen, damit die ganze Bewegung zu diskreditieren.
Am 25. Oktober, also am Vorabend der beiden großen "Answer"-Demonstrationen, gründeten VertreterInnen von (nach eigenen Angaben) mehr als 70 Organisationen ein neues Netzwerk "United for Peace", das allerdings seither nicht über eine gemeinsame Internet-Seite und Terminabsprachen hinausgekommen zu sein scheint. Dazu gehören zwar auch einige linke Kräfte (etwa die GlobalisierungskritikerInnen von "Anti-Capitalist Convergence", verschiedene trotzkistische Grüppchen oder die radikalpazifistische War Resisters League), aber es dominieren kirchliche Organisationen und NGOs (u.a. "Global Exchange"). Das "Answer"/WWP-Umfeld ist an "United for Peace" nicht beteiligt. Damit hat sich die Spaltung von 1990/91 nahezu exakt wiederholt.
Anbiederung von rechts
Gleichzeitig gibt es einige entscheidende historische Unterschiede. Die damalige Antikriegsbewegung entstand vor dem Hintergrund einer massenhaften, auch militanten Bewegung vor allem in den Südstaaten der USA, die damals die sozialen Verhältnisse wirklich zum Tanzen brachte und den Alltag von Millionen von Menschen radikal veränderte: die Bürgerrechtsbewegung (und später die Ghetto-Aufstände in den nördlichen Großstädten). Solch ein gesellschaftlicher Aufbruch fehlt heute.
Außerdem galt damals die Wehrpflicht. Der Vietnamkrieg betraf deswegen einen ungleich größeren Anteil der US-Bevölkerung unmittelbar. Am Ende waren es (neben der Protestbewegung) der jahrelange vietnamesische Widerstand, die 60.000 getöteten US-Soldaten und die zunehmende Rebellion und innere Auflösung der US-Truppen, die die Nixon-Regierung schließlich zum Abzug zwangen.
Ein solch längerer und verlustreicher Krieg ist gegen den Irak aber kaum zu erwarten. Und trotz sinkender Zustimmung zu einem US-Alleingang in den einschlägigen Umfragen sind wohl eher die Widersprüche innerhalb der Eliten um die Frage entscheidend, ob eine militärische Auseinandersetzung mit dem Irak wirklich "den amerikanischen Interessen" dient, wie groß das Risiko einer Destabilisierung der gesamten Region ist, ob eine "Nachkriegsordnung" finanzierbar (und von den USA kontrollierbar) ist, was das Ganze für den "Anti-Terror-Krieg" bedeutet etc. Diese Widersprüche werden auch mit erstaunlicher Offenheit in den Medien, in Think-Tanks und in Strategiezeitschriften ausgetragen.
Im Unterschied zu den Zeiten des Vietnamkriegs gibt es diesmal auch eine rechte Opposition gegen den Krieg - auch "auf der Straße". Manche Rechten versuchen auch eine Anbiederung an die "linke" Friedensbewegung. Eine "Left-Right" Webseite sammelt Kommentare aus beiden Lagern. Und der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Pat Buchanan, ein klarer Antisemit, hat im Sommer eine neue Zeitschrift (The American Conservative) gegründet, die ausdrücklich einer solchen "gemeinsamen" Opposition gegen das "American Empire" gewidmet ist. Die Titelgeschichte der Ausgabe vom 2. Dezember war ein elf-seitiges Interview mit dem eigentlich der Linken zuzurechnenden Romanautor Norman Mailer über "Iraq, Israel and why he is a Left-Conservative" - ein "Cross-over", das für den glühenden Antikommunisten Buchanan noch vor kurzem undenkbar gewesen war. Buchanan ist allerdings einer der wenigen Rechten, die bereits 1990 gegen den damaligen Golfkrieg Stellung bezogen (weil sich die USA damals angeblich "israelischen und jüdischen Interessen" untergeordnet hätten), und der sich damit brüstet, 1999 bei den Anti-WTO-Protesten in Seattle dabei gewesen zu sein.
Manche Linke, wie der bekannte Kolumnist Alexander Cockburn (Counterpunch, The Nation), begrüßen dies: "If the left could reach out to this right (...), then we would really have something" (L.A. Times, 11.11.02). Wie sich die Bewegung als ganzes zu den rechten Cross-over-Versuchen verhalten wird, muss sich erst noch zeigen. Klar ist, dass sich ein solches Bündnis verbietet, wenn man - zumindest als Fernziel - eine der Lieblingsparolen der aktuellen Antikriegs-Bewegung ernst nimmt: "Regime change begins at home".
Michael Hahn
Internet-Adressen:
www.notinourname.net
www.internationalanswer.org
www.unitedforpeace.org
www.nowarblog.org ("left-right")



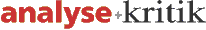 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 468 / 20.12.2002
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 468 / 20.12.2002
