Imperialismus statt "Empire"
Der Irak-Krieg entzaubert eine Theorie
Der Versuch, den drohenden Irak-Krieg unter Rückgriff auf Negri und Hardt zu interpretieren, offenbart einige gravierende Schwächen dieses Ansatzes. Der Rückgriff auf eine fundierte Imperialismustheorie erscheint allemal schlüssiger als ein hartnäckiges Festhalten am "Empire".
Erst zwei bzw. drei Jahre ist es her, seit Toni Negris und Michael Hardts "Empire" erschienen ist. Seitdem wird die Imperialismustheorie ad acta gelegt und die "neue Weltordnung" als "Imperium" ohne Zentrum beschworen. Nationalstaaten spielen demnach auf der internationalen Bühne ebenso wenig eine Rolle wie Interessengegensätze von Staaten oder Kapitalfraktionen. Das Imperium wird als globale, aber dezentrale Machtstruktur begriffen, eine Art vereinheitlichter anonymer Weltkapitalismus, in dem nationalstaatliche Besonderheiten genauso untergehen wie Machthierarchien und zwischenstaatliche Konflikte.
Ein Zampano wie George W. Bush ist in diesem imperialen Szenario nicht vorgesehen, auch nicht eine US-Außen- und Militärpolitik, die offen und unverblümt einen klaren nationalen Führungsanspruch reklamiert und ihn unmissverständlich auch gegen Verbündete durchsetzt. Die Droh- und Machtgebärden der USA im Vorfeld des nächsten Irak-Krieges, die unverfrorene Ignoranz gegenüber internationalen Institutionen, der offene Konflikt mit Deutschland, Frankreich und Russland - dies alles erscheint den Apologenten des "Empire" als "imperialistischer Rückschritt", als "Rückfall", als Anachronismus oder als "Regression". Für Michael Hardt ist die US-Administration nicht auf der Höhe der Zeit, ja, die US-amerikanischen Eliten würden ihre eigenen Interessen nicht kennen und deswegen Unheil über die Welt bringen.
Nun ist es natürlich kurios, wenn sich linke TheoretikerInnen dem Weißen Haus als PolitikberaterInnen anbieten. Und naiv ist die Annahme, ein George Bush, ein Donald Rumsfeld oder ein Richard Cheney würden ihre Interessen nicht kennen. Die Hardt'schen Absurditäten resultieren aus dem Problem, dass die real existierende Welt nicht so funktioniert, wie es "Empire" behauptet. Sie sind Ausdruck und hilfloses Eingeständnis eines zumindest partiellen theoretischen Scheiterns. Anstatt sich trotzig über "imperialistische Rückfälle" zu beschweren und sich via "Regression" auf die psychischen Defizite der US-Administration zurückzuziehen, bietet die momentane weltpolitische Lage einen guten Anlass, die schicken, aber voreiligen Thesen von "Empire" kritisch zu überprüfen und gleichzeitig über die Aktualität einer Imperialismustheorie nachzudenken.
Wer sich auf "Empire" bezieht, benutzt gern ein seltsam altertümliches Bild von "Imperialismus". Der erscheint darin in erster Linie als eine politische und militärische Konkurrenz von Nationalstaaten, denen es um Eroberung und Einverleibung fremder Territorien geht. Dieses Bild bezieht sich ganz offensichtlich auf das "Zeitalter des Imperialismus" der bürgerlichen Geschichtsschreibung, d.h. auf die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Doch spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg unterscheidet sich die vorherrschende Form imperialistischer Politik und auch des imperialistischen Kriegs wenig von dem, was angeblich so "neu" und typisch für das "Empire" ist: Die Kriege in Korea und Vietnam waren nicht auf die Eroberung und Besetzung von Territorien aus, die unzähligen militärischen Interventionen etwa der USA in Lateinamerika oder von Frankreich und Belgien in Afrika sollten zwar Einflusszonen sichern, aber nicht Territorien erobern. Niemand hat bisher bestritten, dass es sich dabei dennoch um Formen imperialistischer Politik gehandelt hat.
Gleichermaßen sind die ideologischen Figuren vom "Kampf gegen Terroristen", von der "Verteidigung westlicher Werte" und auch vom Krieg als Polizeiaktion nicht so neu, dass man darin gleich den Ausdruck einer neuen Weltordnung sehen müsste. Jede militärische Intervention hat bisher die Abwehr von "Terroristen" (Guerillabekämpfung) und/oder "Kommunisten" (Befreiungsbewegungen an der Macht) bemüht und sich auf die Verteidigung von "Freiheit und Demokratie" berufen. Der "Kampf gegen den Terror" ist als ideologische Konstruktion keineswegs eine neue, "imperiale" Erfindung. Und die "Kriegführung mit niedriger Intensität", etwa in Mittelamerika oder auf den Philippinen, hat den Krieg durchaus auch auf die Ebene von Polizeiaktionen relativiert.
Es ist bisher wenig plausibel gemacht worden, was die "neuen Kriege" von den "alten", imperialistischen unterscheiden soll, warum man also ein ganz neues Theoriengebäude zu ihrer Erklärung braucht. Das bedeutet nicht, dass es heute ausreicht, den Imperialismus durch die vereinfachende Brille eines Lenin aus dem Jahre 1917 sehen zu wollen. Doch es gibt keinerlei Grund, einige wichtige Bausteine einer Imperialismustheorie aufzugeben. Zum einen das Verständnis von Imperialismus als globalisiertem und dynamischem Kapitalverhältnis. Das hat erstmal wenig mit irgendeiner Form von Monopoltheorie zu tun, dafür viel mit einem Verständnis von Klassenantagonismen, die nationalstaatliche Grenzen sprengen. Zum Zweiten war und ist dieses globale Kapitalverhältnis in seinen politischen Ausdrucksformen nicht homogenisiert. Weder in Form eines "Superimperialismus" unter der Dominanz einer Weltmacht ( das war eine Zeit lang Thema unter linken StaatstheoretikerInnen) noch in Form eines konturlosen, dezentralen "Empires".
Wenn der kommende Irak-Krieg eines deutlich macht, so ist das die Fortexistenz innerimperialistischer Widersprüche, d.h. die Existenz von Brüchen und unterschiedlichen Dynamiken im Kapitalverhältnis. Diese artikulieren sich als unterschiedliche Interessen und unterschiedliche nationalstaatliche Politikoptionen. Tom Binger weist darauf hin, dass "Empire" den Bedeutungsverlust des Nationalstaates wohl doch deutlich überschätzt. Die "Renaissance des Nationalstaates" ist in erster Linie ein Ausdruck für die Heterogenität des Kapitals auf internationaler Ebene. Diese Heterogenität ist jedoch alles andere als eine "imperialistische Regression". Sie ist Ausdruck unterschiedlicher Dynamiken der sozialen Konfrontation und in diesem Sinne deutlich auf der Höhe der Zeit.
dk.



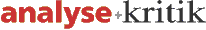 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 471 / 21.3.2003
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 471 / 21.3.2003
