Der Preis für den Frieden
Nur die größten OptimistInnen können ernsthaft glauben, der von der UNO, der EU, den USA und Russland vorgelegte "Fahrplan für den Frieden" ("roadmap for peace") könne den israelisch-palästinensischen Konflikt beilegen und der Nahost-Region alsbald dauerhaften Frieden bringen. Denn die Hindernisse, die den vor zehn Jahren begonnenen Oslo-"Friedensprozess" zum Scheitern brachten, bestehen nach wie vor.
Allen Rückschlägen zum Trotz ist die Mehrheit der israelischen Bevölkerung nach wie vor für den Frieden und für die Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels. Fraglich ist allerdings, ob die Israelis auch den Preis dafür zu zahlen bereit sind: Rückzug der Armee aus den besetzten Gebieten; Abzug der SiedlerInnen aus 85 bis 90 Prozent der Siedlungen; Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten; symbolische Anerkennung eines Rückkehrrechts für palästinensische Flüchtlinge. Die Erfüllung dieser vier Bedingungen, betont Moshe Zuckermann im ak-Interview, ist das Mindeste, was die palästinensische Seite bei Verhandlungen erreichen müsste. Die Alternative zur Zweistaatlichkeit wäre die dauerhafte Annexion der besetzten Gebiete - mit der Folge, dass die jüdischen Israelis zur Minderheit im eigenen Land werden. Während einige deutsche Linke eine "gewisse Subalternität" der PalästinenserInnen hinnehmbar finden, damit Israel als jüdischer Staat erhalten bleibt, warnt Zuckermann vor der Einführung eines Apartheidsystems. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass mit der Schaffung eines palästinensischen Staates wenig gewonnen wäre. Denn ohne wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit Israel wäre dieser Staat nicht lebensfähig. Die für den Austausch unabdingbare Öffnung der Grenzen wäre eine völlige Abkehr von der israelischen Politik der Abriegelung, die für die Bevölkerung des Gaza-Streifens und von Teilen der Westbank zu einer Kollektivstrafe geworden ist und ihnen ein menschenwürdiges Leben unmöglich macht.
Begründet wird die Abriegelung mit legitimen israelischen Sicherheitsbedürfnissen. Unser Autor Achim Rohde, der von einer israelisch-palästinensischen Demonstration gegen den Bau von Sperrzäunen und Mauern berichtet, zeigt hingegen, dass solche Maßnahmen gegen Selbstmordattentäter keinen Schutz bieten. Andererseits wäre es auch naiv zu glauben, der palästinensische Terror würde im Zuge "vertrauensbildender Maßnahmen" von selbst verschwinden. Auch die palästinensische Gesellschaft hat Bedingungen zu erfüllen, um ihre Friedensfähigkeit zu beweisen: Sie muss nicht nur den Mördern die Solidarität entziehen, sie muss auch ein Bewusstsein für die jüdische Leidensgeschichte entwickeln, die nach 1945 den jüdischen Staat Israel zur historischen Notwendigkeit gemacht hat. Mit erheblicher Verspätung hat die Debatte über die welthistorische Dimension der Shoah auch in der arabischen Welt begonnen. In der Vergangenheit wurde die Beschäftigung damit entweder als "nicht opportun" gemieden oder die Shoah gar als "Erfindung des Zionismus" geleugnet. Seit etwa zehn Jahren versuchen arabische Intellektuelle nun, in ihren Gesellschaften einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, indem sie den arabischen Antisemitismus offen bekämpfen - ein schwieriges, aber unverzichtbares Unterfangen, wie Omar Kamil in seinem Beitrag "Araber, Antisemitismus und Holocaust" darlegt. Vielleicht überzeugt auf Dauer das von Edward Said formulierte Nützlichkeitsargument: Die Welt werde "das Leid der Araber erst zur Kenntnis nehmen, wenn die Araber in der Lage sind, das Leid anderer anzuerkennen, auch wenn sie unsere Unterdrücker sind."
Unser Schwerpunkt auf den Seiten 11 bis 16



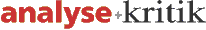 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 473 / 16.5.2003
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 473 / 16.5.2003
