Systemwechsel - aber wohin ?
Die BürgerInnenversicherung als zweifelhafte Alternative in der Sozialpolitik
Weil die Agenda 2010 scheinbar so alternativlos daher kommt, wird jeder Ansatz, der ein bisschen mehr Gerechtigkeit in den sozialen Sicherungssystemen verspricht, begierig aufgesogen. Dies dürfte ein wesentlicher Grund für die Popularität der so genannten BürgerInnenversicherung sein. Eine Popularität, die mehr durch Psychologie als durch Fakten begründet ist.
Die BürgerInnenversicherung hat einen guten Ruf. Gerade auch in linken Kreisen wird sie ausgesprochen freundlich aufgenommen. Sie bzw. ihre Variante "Erwerbstätigenversicherung" soll die Erosion der Sozialkassen aufhalten, gesellschaftliche Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit neu begründen und den weiteren Leistungsabbau in den Sozialversicherungen stoppen - so die allgemeine Erwartungshaltung. Um so erstaunlicher ist es, dass auch Parteien und PolitikerInnen aus der Privatisierungs- und Leistungskürzungsallianz zu den innigsten FreundInnen der Bürgerversicherung gehören.
Die Rürup-Kommission hatte die Zukunftsoptionen "Kopfpauschalen" oder "Bürgerversicherung" alternativ zur Debatte gestellt und damit der BürgerInnenversicherung zu einem ungeahnten Popularitätsschub verholfen. Beiden Modellen ist gemeinsam, dass die Versicherungspflicht verallgemeinert wird und dass die Unterschiede zwischen Privatversicherung und Sozialversicherung nivelliert werden. Beide Versicherungstypen sind für den Bereich der Basisabsicherungen gedacht. Bei der "Kopfpauschale" geht es um eine einkommensunabhängige Festprämie. Die "Bürgerversicherung" soll mit einkommensabhängigen Beiträgen finanziert werden, wobei alle Einkommensarten einbezogen werden sollen.
Die Schweiz: kein Musterländle
Schon vor der Debatte um die Rürup-Alternativen ist in der BRD wohlwollend auf die Schweizer Rentenversicherung hingewiesen worden. Sie wird als das Beispiel einer BürgerInnenversicherung gehandelt. Auch Linke teilen die weit verbreitete Sympathie für das Schweizer Modell der Alterssicherung. Dennoch ist Skepsis angezeigt.
In der schweizerischen "Alters- und Hinterlassenenversicherung" (AHV) sind alle EinkommensbezieherInnen, inklusive der Selbstständigen und UnternehmerInnen, einbezogen. Die Mindestrente liegt bei ca. 1.000 SFr, die Höchstrente bei ca. 2.000 SFr. Kleinstrenten wie in Deutschland, wo ca. 50% der Rentnerinnen eine Rente von weniger als 500 Euro beziehen, sind in der Schweiz nicht möglich. Was in Deutschland über den bedarfsabhängigen Sozialhilfeanspruch oder den Anspruch nach dem Grundsicherungsgesetz geregelt wäre, würde in der Schweiz zumindest teilweise bedarfsunabhängig über die AHV-Rente abgesichert.
Deren Finanzierungsbasis unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Steuerfinanzierung. Sicherlich ist die Beteiligung auch der wohlhabenden Selbstständigen an der Finanzierung des sozialen Sicherungssystems ein richtiger Ansatz. Doch das kann auch erreicht werden, indem die Sozialversicherungen aus der Vermögens- und Kapitalertragssteuer staatlich bezuschusst werden.
Wenn man sich die höheren Schweizer Lebenshaltungskosten vor Augen hält, relativieren sich die Vorzüge der AHV schon beträchtlich. Auch in der Schweiz existiert eine strukturelle Altersarmut. Viele BezieherInnen der AHV-Mindestrente benötigen zur Existenzsicherung Sozialhilfeleistungen. Die Schweizer Lösung hat aber noch weitere Schwächen. Für ArbeitnehmerInnen ab ca. 25.000 SFr Jahreseinkommen gilt eine obligatorische kapitalgedeckte betriebliche Altersvorsorge. Erst zusammen mit dieser erreicht ein/e SchweizerIn mit durchschnittlicher Erwerbsbiografie ein Rentenniveau, das in etwa mit dem der gesetzlichen Rente in Deutschland vergleichbar ist.
Kapitaldeckungselemente spielen in der Schweiz eine sehr viel größere Rolle als in Deutschland oder Frankreich. Mittlerweile ist auf diese Weise ein Kapital von 500 Mrd. SFr angespart worden. Das hatte zu schweren Turbulenzen in der Schweizer Alterssicherung geführt, denn durch die Börsenkrise wurde ein beträchtlicher Teil dieses Vermögens entwertet. Viele Pensionskassen und Versicherungen sind nicht mehr in der Lage, die Verpflichtungen aus den Pensionsplänen zu erfüllen. So steht zwischenzeitlich eine Absenkung des gesetzlich gesicherten Garantiezinses von vormals 4 % auf unter 2,5 % auf der Tagesordnung.
Die Schweizer Lösung weist auf die historischen Handicaps einer Volks- oder BürgerInnenversicherung hin. Volksversicherungen ähneln steuerfinanzierten Elementarsicherungssystemen, bei denen die Leistungen von vorneherein nicht bedarfsdeckend sind. Für die wohlhabenden und gutverdienenden BeitragszahlerInnen muss das auch nicht sein, weil man sich neben der staatlichen Grundsicherung komfortabel privat versichern kann. So kommen Beiträge und Leistungen von den BürgerInnenversicherungen über ein unteres oder maximal mittleres Niveau nicht hinaus.
In der BRD wird die BürgerInnenversicherung vor allem im Bereich der Krankenversicherung als Alternative zu dem neo-liberalen Modell der Kopf-Pauschalen verstanden. Die Vorschläge von Horst Seehofer (CSU) oder Krista Sager (Grüne) sind allerdings noch problematischer als die beschriebenen Defizite der AHV und die kapitalgedeckten Zusatzsysteme in der Schweiz.
Viel Zustimmung bekommt die BürgerInnenversicherung deshalb, weil alle Einkommensarten, also auch Mieten, Pachten und Kapitalerträge, bei der Beitragserhebung berücksichtigt werden sollen. Versicherungspflichtig wären alle BürgerInnen, nicht nur die Lohnabhängigen. Dieser egalitäre Eindruck wird aber durch die konkrete Ausformung nicht gestützt.
Versorgung an der Armutsgrenze
Zum einen soll es weiterhin eine Beitragsbemessungsgrenze geben. (1) Das Einkommen von wohlhabenden und reichen Versicherten geht also nur in geringem Umfang in die Umverteilung ein. Zum anderen wird mit der formalen Einbeziehung auch der Kapitaleinkommen die bisherige paritätische, Lohnsummen bezogene Finanzierung durch die Arbeitgeber in Frage gestellt. Der grüne Außenminister hat das als ersten Schritt zum Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge eingefordert.
Bei der Sicherung des Beitragsaufkommens durch die Arbeitgeberbeiträge geht es nicht um ein abstraktes Prinzip (Parität). Deren Abschaffung führt vielmehr zu negativen Verteilungseffekten. Der sukzessive Wegfall der Arbeitgeberbeiträge entlastet den Unternehmenssektor und die Beitragsbemessungsgrenze die wohlhabenden Haushalte. Ideologisch passt dazu, dass auch die Kampagne für die BürgerInnenversicherung mit dem standortpolitischen Dogma der Beitragssatzsenkung und niedriger Lohnnebenkosten verbunden ist.
Noch gravierender sind die gesundheitspolitischen Konsequenzen für das Leistungsniveau. Karl Lauterbach, wichtigster Theoretiker der BürgerInnenversicherung in Deutschland, macht kein Hehl daraus, dass die Einführung der BürgerInnenversicherung mit einer Einschränkung des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden ist. Teile des Leistungsumfangs der Gesetzlichen Krankenversicherung sind für ihn "Luxusmedizin". Alle Leistungen, die über den neu definierten reduzierten Leistungskatalog hinausgehen, müssen privat dazugekauft oder privat versichert werden.
Im Bereich der Krankenversicherung ist BürgerInnenversicherung somit gleich bedeutend mit einer kargen Grundabsicherung für einen großen Teil der Bevölkerung. Wohlhabende, jüngere und gesunde VersicherungsnehmerInnen werden sich durch private Zusatzversicherungen in den oberen Etagen einer Mehrklassenmedizin bewegen können. Der egalitäre Schein trügt also. Die schon vorhandenen sozialen Unterschiede und Ausschlüsse im Gesundheitswesen werden durch die BürgerInnenversicherung noch größer.
Bei den privaten Versicherungen wird sich das Verhältnis von Voll- zu Zusatzversicherung radikal verändern. Wenn die privaten Versicherer z.Z. noch gegen die BürgerInnenversicherung polemisieren, so ist das wenig mehr als ein alter Beißreflex gegen ältere linke Konzepte einer Einheitsversicherung. Die meisten VertreterInnen der Branche haben nur noch nicht erkannt, dass die umfangreichen Zusatzversicherungen zur rudimentären "Bürgerversicherung" ein ähnliches lukratives Geschäft darstellen können wie die Vollversicherungen.
Politisch hat die Debatte um die BürgerInnenversicherung den Zweck, das große Unbehagen über die unübersehbaren Ungerechtigkeiten der rot-grünen Sozial"reformen" aufzugreifen und zu kanalisieren. Andererseits ist sie auch ein Indiz dafür, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit in der politischen Konsensbildung immer noch eine große Rolle spielt. Hier wären also Anknüpfungspunkte für eigenständige linke Projekte.
Es spricht einiges dafür, die Sozialversicherungen als Solidar- und Risikofonds aller abhängig Arbeitenden - unabhängig vom formalen Vertragstyp im Arbeitsverhältnis - auf Umlagebasis weiter zu entwickeln. In diesem Risikokollektiv dürfte politisch eher ein Konsens über ein ausreichendes Leistungsniveau herzustellen sein. In alle Sozialversicherungstransfers müssen Elemente von Grund- und Existenzsicherung eingebaut bzw. ausgeweitet werden. Die Beitragsbemessungsgrenze ist sukzessive an- und zumindest in der Gesetzlichen Krankenversicherung mittelfristig aufzuheben. Die Versicherungspflichtgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung hat keine Existenzberechtigung.
Der Wettbewerb auch der gesetzlichen Krankenversicherungen um gute Risiken und niedrige Beitragssätze ist kontraproduktiv. Eine Ausweitung des Finanz- bzw. Risikostrukturausgleichs ist ein vernünftiger erster Schritt. Am Ende muss aber eine einheitliche Finanz-, Leistungs- und Beitragsverfassung stehen - bei sinnvollen dezentralen Verwaltungsstrukturen und mit einer Stärkung der Selbstverwaltung.
Umlage plus Umverteilung
In allen Bereichen der Sozialversicherung gibt es derzeit keine praktikable Alternative zur formalen Aufteilung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen der Beitragslast. Realwirtschaftlich betrachtet handelt es sich so oder so um Lohn. Dennoch sind - wie etwa im Bereich der Künstlersozialversicherung - auch modifizierte "Arbeitgeberbeiträge" ausbaufähig. So wäre es interessant, die AuftraggeberInnen von kleinen, zwar formal, aber nicht wirtschaftlich Selbstständigen an der Finanzierung von deren Sozialversicherung zu beteiligen.
Es gibt andere theoretische Alternativen oder Ergänzungen zu den Arbeitgeberbeiträgen, etwa die Wertschöpfungsabgabe. Als Maßstab für die Einschätzung all dieser Modelle muss aber gelten, dass der Unternehmenssektor per saldo nicht entlastet werden darf. Eine Verstetigung des Bundeszuschusses zur Gesetzlichen Rentenversicherung (und auch zur Arbeitslosenversicherung) ist ein weiterer Beitrag zu Stabilisierung der Einnahmebasis und Finanzierung von Reformen in der Sozialversicherung (wie z. B. der Einführung von existenzsichernden Mindestansprüchen).
Unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten geht es vordringlich um eine effektivere Beteiligung von wohlhabenden Selbstständigen und anderen wohlhabenden EinkommensbezieherInnen an der sozialen Infrastruktur. Das heißt auch, dass Instrumente wie die Körperschaftssteuer oder die Einkommens- und Vermögenssteuer neu ins Spiel gebracht werden müssen. Diese verteilungspolitische Auseinandersetzung kann durch keine andere Debatte ersetzt werden; auch nicht durch eine wie oben skizzierte linke Beitragspolitik in den Sozialversicherungen, die auf eine breitere Bemessungsgrundlage abstellt.
Andreas Bachmann
Anmerkung:
1) Im Gespräch ist eine Bemessungsgrenze von ca. 3.500 Euro für den ersten Aufschlag der BürgerInnenversicherung. Insbesondere die Grünen sind für diese Variante, während Prof. Lauterbach die Bemessungsgrenze immerhin auf 5.100 Euro erhöhen will.



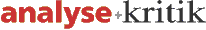 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 478 / 21.11.2003
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 478 / 21.11.2003
