Zwischen zwei Republiken
Der "Umbau" des Sozialstaates und die Perspektiven des Widerstandes
Die Agenda 2010 markiert einen historischen Bruch, die Abkehr vom "Rheinischen Kapitalismus". Die sozialen Bewegungen haben bisher sehr unzureichend auf diesen Bruch reagiert; in mancherlei Hinsicht muss die Antwort auf die "Krise des Alten" noch erfunden werden. Der folgende Artikel ist ein Redebeitrag, den Martin Dieckmann, Sekretär beim ver.di-Bundesvorstand, Ende Oktober auf einer Veranstaltung der WählerInnenvereinigung REGENBOGEN - Für eine neue Linke in Hamburg gehalten hat.
Was sich zurzeit in Deutschland ereignet, ist nicht mehr und nicht weniger als ein historischer Bruch mit den Regelungsgrundlagen dessen, was den "sozialen Rechtsstaat" bislang ausgemacht hat. Der Bruch ist programmatischer Art. Er folgt zum einen bereits vollzogenen, erheblichen Veränderungen in der sozialen und politischen Praxis, zum anderen gibt er diesen eine neue Dynamik. Und es ist die Sozialdemokratie selbst, die diesen Bruch vollzieht. Die Sozialdemokratie ist so auf dem Weg, nach Erfurt und Bad Godesberg ihr drittes historisches Parteiprogramm zu schreiben: In Erfurt erklärte sie sich zur marxistischen Klassenpartei, in Bad Godesberg kam sie programmatisch als linke Volkspartei im Kapitalismus an. Das dritte historische Programm der Sozialdemokratie braucht keine papierene Fassung und demnach auch keinen Autor mehr. Es findet praktisch statt und wird auf Dauer die Sozialdemokratie in ihrer bisherigen Gestalt als Volkspartei zu einer Figur des Verschwindens machen. Sie wird nämlich so nicht mehr gebraucht.
Der programmatische Bruch mit der Republik des "Rheinischen Kapitalismus" - also die westdeutsche Ausprägung dessen, was man den fordistischen Wohlfahrtsstaat genannt hat - vollzieht sich gleichzeitig auf zwei Feldern; zum einen dem der Sozialversicherung, sowohl in Hinsicht auf die paritätische Finanzierung als auch auf das Solidarprinzip. Die paritätische Finanzierung war und blieb Ausdruck des grundlegenden, freilich auch immer umkämpften "Klassenkompromisses". Sie stellte vom Grundsatz her eine Umverteilung auch von oben nach unten sicher, während das Solidarprinzip eine Umverteilung im Volk regeln sollte. Das zweite Feld, auf dem der programmatische Bruch erfolgt, sind die Regelungsgrundlagen der Tarifpolitik. Kanzler Schröder hat in der Regierungserklärung vom März 2003 die Gewerkschaften unmissverständlich mit der Erpressung konfrontiert, entweder freiwillig die bindende Wirkung von Tarifverträgen erheblich zu schwächen oder aber sich dies gesetzlich diktieren lassen zu müssen. Hier wird programmatisch nachvollzogen, was in der Praxis schon vorherrschende Tendenz ist: Tarifpolitik nur noch unter dem Gesichtspunkt von Kostenbelastung zu thematisieren und nicht mehr als grundlegendes Regulativ von Märkten.
Mit der These eines programmatischen Systemwechsel in den Regelungsgrundlagen des "sozialen Rechtsstaats ist auch die historische Dimension dieses Bruchs angedeutet: das Ende der Republik des "Rheinischen Kapitalismus" und damit der Übergang zu einer anderen Republik. Dabei befindet sich das Alte nunmehr erdrutschartig in Auflösung, ohne dass das Neue halbwegs stabile Konturen bekommt. Mit der radikalen Auflösung der bisherigen sozialstaatlichen Regelungsgrundlagen sind unendlich viele Fronten und Kampffelder eröffnet. Und es ist nicht abzusehen, wie und wann sich in diesem Prozess, der als Gesamtheit von sozialen Konflikten und Kämpfen ja erst beginnt, auch auf Seiten der Herrschenden strategische Klassenbündnisse entstehen. Bei einem Erdrutsch geht es abwärts; man muss sich also auf einen längeren Zeitraum einstellen, in dem es zunächst einmal kein Halten mehr gibt.
Es gibt absehbare und unabsehbare Folgen dieser Entwicklung: Absehbar ist ein erneuter Schub in der "Umverteilung von unten nach oben", absehbar sind ferner weitere schwere Verwerfungen im sozialen Gefüge und - was schon heute einen Großteil des sozialen und politischen Dramas ausmacht - eine "mentale Zerrüttung" im Volk. Unabsehbar sind die unmittelbaren und mittelbaren ökonomischen Konsequenzen. Es gibt nicht wenige, die aus rein immanenter Sicht vor verheerenden Folgen für den gesamtwirtschaftlichen Prozess warnen; hierfür steht als Schreckensszenario die Freisetzung unkontrollierbarer deflationärer Tendenzen. Und damit haben sie Recht. Bevor es also ein neues, hegemoniales Regime geben kann, wird es eine Abfolge von Krisen-, wenn nicht sogar Notstands-Regimen geben.
Auf dem Weg in eine andere Republik
Es geht nicht darum, apokalyptische Schreckensbilder an die Wand zu zeichnen, wohl aber um eine realistische Einschätzung der Kräfte (wie auch der Klassenverhältnisse), die diese Entwicklung möglich gemacht haben. Es kann doch nicht nur darum gehen, mit der Beschleunigung von Appellen einen Widerstand zu beschwören, der heutzutage ja allemal nur Protest ist. Warum selbst dieser Protest vergleichsweise schwach ist, bedarf einer Erklärung. Mobilisierung für Aktionen, Demonstrationen usw. sind eine Selbstverständlichkeit. Aber warum bringt uns das nicht weiter (außer am Ende als Minorität Recht behalten zu haben)? Es stellt sich nicht nur die Frage, wofür wir kämpfen, sondern auch, mit wem wir kämpfen können. Wir müssen uns vor allem mit dem Widerstandspotenzial der Herrschenden auseinander setzen, um über die naturgemäß hektische Mobilisierungspolitik hinaus strategiefähig zu werden.
Die heutige Regierungspolitik bedeutet auch einen grundlegenden Wandel dessen, was historisch einmal als "strukturelle Reformmehrheit" unter dem Dach von Rot-Grün gehandelt worden ist. Dieses Projekt der "sozial-ökologischen Reformen" aus den 1980er Jahren hatte gewissermaßen den Reformismus der alten ArbeiterInnenbewegung beerbt. Es sind insbesondere die so genannten neuen Mittelschichten - man könnte sie auch als Elite der lohnabhängigen Klasse bezeichnen - gewesen, die gleichermaßen Träger wie RepräsentantInnen solcher Reformansprüche gewesen sind. In Anspielung auf die viel zitierte "Angst vorm Absturz" der Mittelschichten hat Frank Deppe kürzlich auf den grundlegenden Wandel in diesen Klassenmilieus hingewiesen. Sowohl sozial wie politisch haben insbesondere die Milieus, die das Klientel der Grünen bilden, den Aufbruch von 1968 und die Reformpolitik nach 1969 beerbt. Sie haben über eine längere Zeit hinweg ideologisch so etwas wie ein solidarisches Bündnis der Mittelschichten mit den subalternen Volksschichten repräsentiert.
Aber - und auch darauf hat Deppe hingewiesen - dies war und blieb ein höchst fragiles Bündnis. Zum einen haben eben diese Milieus der Reformlinken am meisten von den erheblichen öffentlichen Investitionen (in erster Linie in den Bildungsbereich) profitiert, während die anderen diese zu großen Teilen mitfinanzieren mussten. Seitdem aber die "Gegenleistung" in den Solidarbeziehungen gefordert ist, schließen sich diese Milieus immer radikaler nach außen - im sozialen Sinne nach unten - ab. Immerhin muss man sich fragen, warum es eine Partei wie die Grünen schafft, offenbar nicht trotz, sondern wegen ihrer programmatischen Wendungen seit Ende der 1980er Jahre eine stabile und zeitweilig sogar wachsende Wählerschaft zu finden. Zusammen mit der rechts-liberalen Variante, der FDP, ist da ein stattliches und heute aggressives Potenzial zu Gunsten weiterer Deregulierung entstanden. Ihre RepräsentantInnen in der politischen Klasse haben es vermocht, das Erbe von 1968 regelrecht zu privatisieren, und die Phraseologie halbwüchsiger Spontis der 1970er Jahre hat sich transformiert ins Geschwätz grüner Staatssekretäre.
Dem sozialen Ausschluss entsprechen die sozialen Verwerfungen im Volk. Wir erleben eine paradoxe Situation: Noch nie gab es so große Mehrheiten, die nicht nur vom Gegensatz von Reich und Arm, sondern auch von Herrschenden und Beherrschten überzeugt waren. Und noch nie dominierte gleichermaßen erdrückend eine passive Akzeptanz gegenüber der herrschenden Politik. Die Gründe für diese Paradoxie sind nicht einfach mangelnder Aufklärung geschuldet, sondern in der Hauptsache einer fundamentalen Veränderung in den gesellschaftlichen Basisprozessen, zuallererst in den Arbeits- und Reproduktionszusammenhängen. Mit dieser Veränderung ist der tatsächlich große Erfolg der herrschenden Strategien gemeint, so gut wie sämtliche sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen dem ökonomischen Rentabilitätskriterium zu unterziehen: dadurch, dass "Märkte" als Steuerungsmodell sozialer Prozesse implementiert und somit die Gesamtheit sozialer Beziehungen auf Kunden-DienstleisterInnen-Beziehungen reduziert werden können. Der Tendenz nach handelt es sich dabei um eine kapitalistische "Kolonisierung der Lebenswelten", eine "innere Landnahme" durch das Kapital. Die Schwäche des bisherigen politischen Protests verweist hier auf die langfristige Perspektive: Wenn es nicht gelingt, in eben diese Basisprozesse einzugreifen, bleiben wir dauerhaft konfrontiert mit einem gespaltenen Massenbewusstsein, dessen Paradoxien - von Unterwerfung und Protest - sich genau diesen Unterwerfungsstrategien verdanken.
Potenziale und Perspektiven
Es gibt eine Diskussion darüber, ob wir schon von einem neuen System kapitalistischer Regulation sprechen können. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sich ein neues "Akkumulationsregime" bereits durchgesetzt hat. Eher hat sich ein Krisenregime etabliert, das in der weiteren Folge zu einem regelrechten Notstandsregime auswachsen kann. Der Grund dafür, eher die Krise des Alten als die Ankunft des Neuen zu vermuten, liegt in der hegemonialen Schwäche dieses Krisenregimes. Die Fronten verschieben sich täglich, es gibt so gut wie keine soziale Gruppe, die verschont bleibt. Das aggressiv-liberalistische Potenzial ist zwar Motor des Prozesses, es ist aber selbst nicht bündnisfähig. Noch nicht. Zudem gehen die politischen Bindungen - zum Beispiel an Parteien, damit das gesamte System der Volksparteien - beschleunigt in die Brüche.
Dass in einer solchen Situation die Hoffnungen des sozialen Protests auf die Gewerkschaften gerichtet sind, kann man verstehen. Diese Hoffnungen sind aber so, wie sie artikuliert werden, illusorisch: Die DGB-Gewerkschaften sind Teil des Alten und damit auch ein wichtiges Regulativ der kapitalistischen Entwicklung. Sie sind zugleich (noch) nicht in der Lage, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Oder sie wollen es schlicht nicht. Entscheidend aber ist, dass die sozialen und politischen Verwerfungen die Gewerkschaften genau so durchziehen wie die gesamte Gesellschaft. Wenn, dann kann nur eine politische und soziale Bewegung - eigenständig, also ganz und gar auf ihre Autonomie bedacht - auch innerhalb der Gewerkschaften Positionsbestimmungen in Richtung auf eine Alternative unterstützen.
Ich nenne hier vier Handlungsebenen, die für eine Diskussion mittel- und langfristiger Widerstandsperspektiven von Bedeutung sind:
Erstens: Es hat sich - was nicht gering geschätzt werden darf - ein internationaler Zusammenhang aus sozialen Initiativen und Bewegungen heraus gebildet, der fragil sein mag, aber als Ganzes einen ungeheuren historischen Fortschritt bedeutet. Mit den "Sozialforen" und dem, was man "globalisierungskritische Bewegungen" nennt, ist etwas entstanden, das sich dem nähert, was einmal "Internationale der Hoffnung" genannt wurde - und was zugleich einen wirklichen Fortschritt nach dem Umbruch von 1989, dem Zusammenbruch der bisherigen, staatlich repräsentierten "Systemkonkurrenz", darstellt.
Zweitens: Zumindest für Europa ergibt sich der Prozess der EU-Integration und ausweitung als strategischer Bezugspunkt. Im Kontext von so genannter Globalisierung und der besonderen Situation eines supra-nationalen oder auch neuen staatlichen Zusammenhangs der EU sind soziale Bewegungen damit gleichermaßen mit dem "Nation-Building" des 19. Jahrhunderts wie den Politik-Vermittlungen des 21. Jahrhunderts konfrontiert. Und wer weiß, wie viele der nationalstaatlichen Belange bereits von der EU geregelt werden, wird wissen, wie bedeutsam ein europaweites Eingreifen ist.
Drittens: Der unmittelbare Handlungsrahmen bleibt der Nationalstaat, und das nicht nur deshalb, weil er nach wie vor - wenn auch in veränderter Konstellation - für jede Form von Regulierungspolitik elementar ist. Der Nationalstaat ist bislang das einzige Terrain, auf dem sich das "Demokratieproblem" und damit die Frage der politischen und sozialen BürgerInnenrechte stellt. Das Verhältnis von Nationalstaat und internationaler Regulierung darf uns nicht nur demokratietheoretisch, sondern muss uns praktisch beschäftigen.
Viertens: Schwerwiegend ist bislang das Defizit der sozialen Protestbewegung dort, wo ich von "Basisprozessen" der Arbeit und Reproduktion gesprochen habe. Es reicht auf Dauer eben nicht aus, lediglich die staatliche Regulierung der Reproduktionsbedingungen zu thematisieren und anzugreifen. Wenn es den heutigen Sozialbewegungen nicht gelingt, hier unmittelbar in die neuen Herrschaftsformen über die Arbeitsprozesse einzugreifen, werden sie beim Protest bleiben und nicht zum lang anhaltenden Widerstand übergehen können.
Klassenbrüche - Klassenbündnisse
Zur Perspektive gehört die Alternative. Darauf reduziert, die "Umverteilung von oben nach unten" einzuklagen, bleibt wenig von dem übrig, was wir uns selbst - unter uns - vorstellen. Anders gesagt: Die berechtigte Weigerung, die "Umverteilung in der Klasse" diskutieren zu wollen, ohne gleichzeitig die Umverteilung "von oben nach unten"zu thematisieren, gerät in ein Dilemma. Denn wenn nicht zugleich deutlich wird, was die eigenen Vorstellungen von Solidarität und Gerechtigkeit konkret bedeuten, wenn es also lediglich dabei bleibt, die historischen Verteilungsmechanismen und -kriterien abstrakt zu verteidigen, dann wird die Linke so oder so keinerlei Ausstrahlungskraft gewinnen.
Auf den genannten Handlungsebenen alternative Entwürfe zu erarbeiten, zu diskutieren und sie so erst propagieren zu können - das wäre eine in jedem Fall notwendige Bedingung dessen, was hier zu Lande auf der Tagesordnung steht: eine "Neugründung" der politischen Linken, die gleichermaßen programmatisches Zentrum, Motor und auch Dach des sozialen Protests werden kann und muss.
Martin Dieckmann



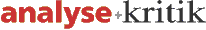 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 479 / 19.12.2003
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 479 / 19.12.2003
