Faktisch taktisch?
Über das Verhältnis der Wahlinitiativen zur Parteipolitik und zu sich selbst
Die Initiative für eine "Wahlalternative" 2006 hat Zulauf. Auch in Berlin hat sich eine Initiative Berliner Wahlalternative gegründet, die mit dem Slogan "Berlin ist reif für eine politische Alternative!" wirbt. Deren vorrangiges Ziel ist die Abwahl des rot-roten Senats. In ihrem Aufruf ist zu lesen, dass ein "Volksbegehren zur Abwahl des Senats" eine "mögliche und legitime Antwort" auf deren Politik darstellt. Diese "Frage" würde die Initiative "gemeinsam mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen" erörtern. Dabei steht die Antwort bereits fest: Neuwahlen, bei der eine "Wahlalternative" den etablierten Parteien das Fürchten lehren soll. Die vielleicht nur missglückte Formulierung aus dem Aufruf ist symptomatisch für die Debatte um eine Wahlalternative. Während die Tatsache, dass eine solche potenziell entstanden ist, nicht all zu viel Unbehagen hervorruft, wundert es doch ein wenig, dass das Wie kaum kritisch diskutiert wird.
Innerhalb der Linken sind vor allem zwei Positionen zum wahlpolitischen Vorstoß zu finden: Zum einen die Position, die davon auszugehen scheint, dass die Initiative nichts mit der eigenen Politik zu tun hat und die in der von Norbert Hackbusch in ak 483 beschriebenen Selbstgenügsamkeit verharrt. Diese Position ist bei der absoluten Mehrzahl der Gruppen aus der bewegungsorientierten undogmatischen Linken zu beobachten. Die zweite Position geht davon aus, über das Parlament gesellschaftsverändernd eingreifen zu können. Die Einschätzung, wie weit dies möglich ist, variiert vom vollkommen Glauben an die parlamentarische Demokratie bis hin zu einem taktischen Verhältnis zu Parteien und parlamentarischer Politik. Dieser Position lassen sich neben den WahlalternativlerInnen selbst vor allem Teile der Sozialforumsbewegung und von Attac zuordnen.
Die erste Position ist nicht nur selbstgenügsam sondern auch blauäugig. Und zwar vor allem deshalb, weil die Gründung einer Partei, egal wie links sie sich auch immer verstehen wird, auf das Terrain wirkt, auf dem die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stattfinden werden. Vor allem das Verhältnis der verschiedenen Öffentlichkeiten und der herrschenden bürgerlichen Öffentlichkeit wird mit ihr neu geordnet. Es würde ein ähnlicher Effekt wie mit Attac eintreten, die in der bürgerlichen Öffentlichkeit oft und gerne mit der globalisierungskritischen Bewegung in Eins gesetzt wird. Demnach würde die Partei, die noch keinen Namen hat, scheinbar radikale Politik repräsentieren und die Wahrnehmbarkeitsräume der Politik außerparlamentarischer Gruppen würden enger werden.
Sag mir,
wo du stehst ...
Zur zweiten Position: Diejenigen, die immer noch glauben, über den Parlamentarismus die Gesellschaft grundlegend verändern zu können, sind weniger geworden. Kaum eine linke Partei, auch nicht die PDS, die nicht ständig betont, wie wichtig außerparlamentarische Organisierung sei. Und dennoch: Das Verhältnis ist meist ein instrumentelles. "Richtige Politik" findet im Parlament statt. Völlig ausgeklammert wird die noch Anfang der 80er Jahre in kritischen Sozialwissenschaften verbreite Kenntnis von der Funktion des Parlamentarismus und den Grenzen der parteipolitischen Möglichkeiten. Parteien zielen auf den Staatsbürger als Wähler. Sie müssen, wollen sie gewählt werden, möglichst viele Menschen ansprechen. Parteien müssen - anders als soziale Bewegungen, die sich in der Regel an partikularen Interessen organisieren - die Koexistenz verschiedener Widersprüche oder Konflikte organisieren. Dabei kann es durchaus dominante Widersprüche geben. Die Grünen wären sicherlich bereits überflüssig, wenn sie nicht ständig suggerieren würden, nur mit ihnen würde die Frage der Ökologie adäquat vertreten.
Aber genau dieser Zwang, Widersprüche auf allgemeiner Ebene vereinheitlichen zu müssen, führt dazu, dass ständig von "der Mehrheit der Bevölkerung" geredet wird, die es zu gewinnen gilt. Genau das nicht gemacht zu haben, sieht zum Beispiel Michael Prütz, Mitinitiator der Wahlalternative in Berlin als Ursache für die Niederlage von Regenbogen bei der Hamburger Bürgerschaftswahl: "Meiner Meinung nach hat Regenbogen einen grundsätzlich falschen, einen typisch linken Milieuwahlkampf geführt. Sie haben die Probleme nicht zugespitzt, die die Hamburger bewegen. Wenn man solche Punkte aufgreift, dann hätten auch Wahlalternativen Erfolgsaussichten." (ND 3.3.2004) Wer Politik für "die" HamburgerInnen machen will, kann nur in Leerformeln wie "sozialer Gerechtigkeit" im Nebel stochern und möglichst glaubwürdig dabei aussehen.
Neben der Selektion bestimmter Inhalte, besteht eine regulative Funktion von Parteien darin, die gesellschaftliche Interessen nach der Logik staatlicher Politikformulierungs- und Entscheidungsprozesse zu polarisieren und zusammenzufügen. Das ist bereits in den potenziellen Wahlalternativen zu sehen: Politische Programme werden nach der Logik der Umsetzbarkeit formuliert. So heißt es bei der Wahlalternative 2006, dass die Finanzierung staatlicher Politik im wesentlichen eine Verteilungsfrage sei. Hier habe man "Alternativen" anzubieten: "Sie sind konkret und sie sind machbar." Und vor allem: "wirtschaftspolitisch besser"! Hier bricht sich der Versuch Bahn, die eigene Regierungsfähigkeit schon vor Gründung zu proklamieren. Joachim Bischoff, einer der führenden Köpfe der bundesweiten Initiative, betont, dass es nicht darum gehen könne, "sich wegen dieser Deformation politischer Strukturen nicht auf das parlamentarisch-politische Terrain zu begeben, sich auf die Rolle von Ideengebern zu beschränken und die Umsetzung anderen zu überlassen." (SoZ 04.2004) Es zeigt sich zweierlei: Zum einen geht es tatsächlich um die staatliche Umsetzung eigener Vorschläge, nicht um eine Fundamentalopposition im Parlament, die ihre Grenzen und Möglichkeiten kennt. Zum anderen zeigt sich, dass der Glaube an die parlamentarische Demokratie bei den ProtagonistInnen der aktuellen Wahlbewegung stark verwurzelt ist. Nicht die Form des Parlamentarismus verunmöglicht laut Bischoff eine "andere Welt", sondern nur dessen Deformation.
Woher nehmen die diversen Initiativen den Glauben, dass sie nicht unter die Räder der Institutionen kommen werden? Manche sagen, dass die Wahlalternative eine Partei neuen Typs (Axel Troost, ND 1.5.2004) darstellen soll. Das Neue soll vor allem in der Verbindung zu sozialen Bewegungen bestehen. Wie das konkret aussehen soll, bleibt unklar - vor allem wohl deshalb, weil die Initiative kein Ausdruck sozialer Bewegungen ist.
Ein Beispiel aus Berlin mag verdeutlichen, was gemeint ist: In der Erklärung der Berliner Wahlinitiative heißt es: "Nach einer intensiven Debatte hat die Initiative Berliner Wahlalternative beschlossen, einen Auslotungsprozess zu Chancen und Perspektiven zu beginnen. Dabei gilt es, gemeinsam mit Gewerkschaftern, Globalisierungskritikern, kritischen Wissenschaftlern, Aktiven der sozialen Bewegungen und allen anderen, die nach Alternativen suchen, einen offenen Diskussions- und Verständigungsprozess zu organisieren." Stellt sich die Frage, wie dieser Prozess aussehen soll. Als im Berliner Sozialforum (BSF), einem Versuch, sich jenseits von Parteien gemeinsam zu organisieren, die Frage nach der politischen Handlungsfähigkeit aktuell wurde, bildeten sich zwei Fraktionen: Die "Beschleuniger" drängten auf schnelle inhaltliche Homogenisierung des Sozialforums, um nach außen mit klaren Positionen auftreten zu können. Demgegenüber gaben die "Bremser" der Idee vom Sozialforum als einem Raum des Austausches den Vorzug - um den Preis, nicht als einheitlicher Akteur in Erscheinung treten zu können. (vgl. ak 481) Weil eine schnelle inhaltliche Homogenisierung im BSF nicht möglich war, riefen die "Beschleuniger" ein "Bündnis gegen Sozialkahlschlag" ins Leben. Aus diesem Bündnis heraus wurde u.a. das Volksbegehren zur Abwahl des Senats auf den Weg gebracht. Noch vor der Demo am 3.April war nur das Volksbegehren im Gespräch. Michael Prütz, Sprecher des Bündnisses, sagte zu diesem Zeitpunkt scheinbar unbeteiligt: "Wir gehen davon aus, dass sich gleichzeitig eine Wahlalternative bildet." Wenige Wochen später ist er als Kontaktperson für eine solche angegeben. Die im Berliner Aufruf formulierte Frage, welche "Struktur" eine "Wahlalternative im Verhältnis zu Gewerkschaften und außerparlamentarischer Bewegung" annehmen soll, ist also bereits geklärt: keine, wenn zu lange diskutiert wird und Selbstorganisierungsprozesse Priorität haben.
... und welchen Weg du gehst
Man könnte meinen, diejenigen, die ein taktisches Verhältnis zur Parteipolitik zu pflegen behaupten, sollten aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gelernt haben. Doch haben sie bisher nicht offen gelegt, was das "Taktische" in ihrem Verhältnis zur Parteipolitik denn nun ist. Vor allem aber überschätzen sie die gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein "taktisches Verhältnis". Ein solches wäre - wenn überhaupt - nur vor dem Hintergrund einer starken und tief verankerten außerparlamentarischen Opposition möglich. Die gibt es heute, im Gegensatz zur Gründungszeit der Grünen, aber nicht.
Gerade die Initiativen, deren einziger politischer Inhalt darin zu bestehen scheint, Alternativen auf der Ebene der parlamentarische Politik zu suchen, sehen an einem Punkt keine Alternative: an dem der Gründung einer parlamentarischen Vertretung. So heißt es bei der Berliner Wahlinitiative: "Wer die demokratischen und sozialen Errungenschaften verteidigen will, kommt nicht umhin, die Frage wahlpolitischer Alternativen ernsthaft zu diskutieren." Auch Norbert Hackbusch sieht in Parteien und Gewerkschaften "das wesentliche Rückgrat von Widerstand". (vgl. ak 483) Diese Behauptung geht jedoch vollkommen an der Realität vorbei. Bei der Durchsetzung der rotgrünen Reformen organisierten die "klassischen Strukturen" keinen Widerstand sondern den Konsens mit den Subalternen, etwa indem die Gewerkschaften aus Angst vor der eigenen Irrelevanz dem Großteil der Reformen ihren Segen gaben. Ähnliches lässt sich über die Funktion der Grünen bei der Legitimierung der Kriegseinsätze der Bundeswehr seit dem Kosovo-Krieg sagen.
Perspektive
der Passivität
Auch werden falsche Maßstäbe angesetzt, wenn auf die Rolle von linkssozialistischen oder kommunistischen Parteien in anderen europäischen Ländern verwiesen wird. In Italien und Frankreich hatten diese tatsächlich die Funktion, Tausende GenossInnen über Jahrzehnte organisatorisch zu integrieren. Diese für jeweils spezifische Kontexte geltende Erkenntnis kann aber nicht einfach verallgemeinert werden. In Deutschland war genau das Gegenteil der Fall: Durch den frühen Erfolg der Grünen wurde ein großer Teil widerständiger Subjekte in den Block an der Macht integriert, und die Kampferfahrung aus den Revolten nach '68 wurden in Anekdoten und Jugendsünden transformiert. Ein Transfer von Kampferfahrung ist durchaus von Nöten. Aber die Form dafür unabhängig von den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen und sozialen Kräfteverhältnissen einfach nur einzufordern, ist schlechter Idealismus.
Anstatt vorschnelle und falsche Antworten zu geben, wäre es von Nöten, zunächst die richtigen Fragen zu stellen bzw. die Debatte um strategische Perspektiven zu führen. Die Initiativen gehen tatsächlich davon aus, dass die Hunderttausende, die letztes Jahr im November und dieses Jahr Anfang April auf der Straße waren, ein Zeichen des Aufbruchs sind. Wie können für diese Vielen politische Perspektiven aussehen, in denen sie selbst als handelnde Subjekte vorkommen? Auch wenn es schwierig ist, muss hier die Priorität liegen und nicht in der Verdammung potenzieller WählerInnen zur Passivität.
In den Sozialforen wurde immerhin versucht, unterschiedliche Interessen nicht mehr als die Grenze der eigenen Politik zu verstehen, sondern als Voraussetzung dafür. Genau diesen Prozess werden die Wahlinitiativen kaputt machen, weil sie wie jede andere Partei gezwungen sind, über die verschiedenen Interessen hinwegzugehen und sie in einer Weise zu verarbeiten, dass ein politisches Projekt für "die Mehrheit der Menschen" dabei heraus kommt. Doch allein auf die Größe des linken Lagers zu schielen, ohne dies an einer Qualität fest zu machen, ist wohl eher schlechter Populismus als eine Überwindung linker Selbstverliebtheit und -genügsamkeit.
Ingo Stützle
Zu den Quellen aus ak 483 kommt hinzu:
http://www.berliner-wahlalternative.de/



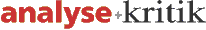 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 484 / 21.5.2004
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 484 / 21.5.2004
