Nicht post oder neo, sondern anti
120 Jahre nach der Berliner Kolonialkonferenz findet ein Antikolonialer Kongress statt
In diesem Jahr jährt sich zum 100. Mal der Massenmord deutscher Kolonialtruppen an den Herero und Nama im damaligen "Deutsch-Südwestafrika". Vor 120 Jahren, am 15. November 1884, begann die Afrikakonferenz, zu der Reichkanzler Otto Graf von Bismarck zwölf europäische Regierungschefs sowie die des Osmanischen Reiches und der USA nach Berlin eingeladen hatte, um Afrika wie einen Kuchen aufzuteilen. An diese beiden Ereignisse möchte die Anticolonial Africa Conference, die Mitte November in Berlin stattfindet, erinnern und koloniale Kontinuitäten beleuchten.
Der deutsche Kolonialismus ist hier zu Lande kaum im öffentlichen Bewusstsein; eine kritisch-aufklärerische Erinnerungskultur an die Verbrechen in Afrika, China und der Südsee existiert nicht. Manche Autoren, etwa Reinhart Kößler, sprechen von "öffentlicher Amnesie". Auch in der internationalistischen Linken hielt und hält sich die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus in Grenzen.
Die Ansicht, dass der Kolonialismus zwar schlimm war, dass die kolonialisierten Gesellschaften aber auch von den "Segnungen des weißen Mannes" profitiert hätten, ist weit verbreitet. Immer noch gibt es die Legende vom tüchtigen und guten Deutschen, der in Afrika Eisenbahnen und Straßen gebaut und den Schwarzen die Zivilisation gebracht habe. Und, so heißt es, Deutschland habe nur kurze Zeit Kolonien gehabt und sei weniger brutal als die Briten oder Franzosen mit den Untergebenen umgegangen. Die Kolonialmächte standen sich in nichts nach, was die Ausplünderung von Land und Leuten anging. Auch die deutschen Schutztruppen haben Kolonialkriege geführt und schlugen den Widerstand der Kolonisierten brutal nieder.
Ein zentraler Aspekt der Geschichte deutscher Kolonialherrschaft sowie der weiteren gesellschaftlich-politischen Entwicklung Deutschlands im 20. Jahrhundert ist der Kolonialkrieg 1904 bis 1908 und der damit verbundene Massenmord an den Herero und Nama im damaligen "Deutsch-Südwestafrika", den mehrere Wissenschaftler als Völkermord bezeichnen (vgl. Jürgen Zimmermann und Joachim Zeller: Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Christoph Links Verlag, Berlin 2003). Tatsache ist, dass der deutsche Kolonialkrieg im heutigen Namibia nach den Maßstäben der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes von 1948 eindeutig den Tatbestand des Genozids erfüllt.
Das Ausmaß der unverblümten Öffentlichkeit, das den Völkermord begleitete, in der Politik und in den Medien, ist bemerkenswert. Postkarten von Gefangenen in Ketten, Konzentrationslagern und Hinrichtungsszenen wurden hergestellt, auch Bilder von Herero-Frauen, die mit Glasscherben die Schädel ihrer Verwandten säubern mussten, um sie in das Pathologische Institut Berlin schicken zu können. Dass die Deutschen die angekündigte Vernichtung von Bevölkerungsgruppen mitbekommen und mitgetragen haben, war ein Tabubruch am Anfang des 20. Jahrhunderts, der aber nie als solcher empfunden wurde.
Die Kolonialherrschaft prägt, wenn auch nicht immer bewusst, die Gesellschaften Europas bis heute, etwa durch die Konstruktion der "Whiteness". Aber für die Opfer war die Kolonisierung ein wesentlich tieferer Einschnitt in die Geschichte als in die der Kolonialherren. Für die Nachfahren der Opfer ist Amnesie in aller Regel keine Option. Die schmerzvolle koloniale Durchdringung der Natur, der Körper und des Bewusstseins führte oft zu einem radikalen Bruch mit der kulturhistorischen Identität und zu einem großen materiellen Verlust.
Konzentrationslager auf Postkarten
Zudem wurde mit dem Kolonialismus eine Entwicklung beschleunigt und zementiert, die mit dem Entstehen des Kapitalismus seinen Ausgangspunkt genommen hatte: die Produktion von extremen Ungleichheiten zwischen den Nationen. Wie Mike Davis in seinem Buch "Die Geburt der Dritten Welt" hinweist, gab es Ende des 18. Jahrhunderts zu den vertikalen Ungleichheiten innerhalb der großen Gesellschaften keine entsprechenden dramatischen Einkommensunterschiede zwischen den Nationen. Erst als begonnen wurde, die Landwirtschaft außerhalb Europas in die Weltwirtschaft zu integrieren, entwickelten sich die großen Einkommens- und Vermögensungleichheiten. "Die Unterschiede im Lebensstandard zwischen einem französischen Sansculotten und einem Bauern des Dekhan waren relativ unbedeutend im Vergleich zu der Kluft, die beide von ihren jeweiligen herrschenden Klassen trennte", so Davis. Spätestens am Anfang des 20. Jahrhunderts allerdings waren die Ungleichheiten zwischen den Nationen so groß wie die Ungleichheit zwischen den Klassen.
Abgesehen davon führte der Kolonialismus zu neuen Staatsgründungen. Antikoloniale Kämpfe dienten als nationaler Gründungsmythos. So gilt der Maji-Maji-Aufstand, der 1905 im Südosten des heutigen Tansanias begann, heute als Ausgangspunkt der Unabhängigkeits-Bewegung in Tansania und bildet ein Kernelement des dortigen nationalen Identitätskonstrukts.
Mitte November, 120 Jahre nach der kolonialen Afrika-Konferenz, findet in Berlin die Anticolonial Africa Conference 2004 statt. Seit über einem Jahr wird sie von einer Gruppe vorbereitet, zu der Einzelpersonen aus verschiedenen afrikanischen und europäischen Ländern zählen. Unterstützungsgruppen sind außerdem die Antirassistische Initiative Berlin (ARI), die Forschungsstelle Flucht und Migration (FFM) und die Brandenburger Flüchtlingsinitiative.
Geplant ist eine Gedenkfeier für die Opfer der deutschen Kolonialkriege in Afrika an der "Neuen Wache", Unter den Linden in Berlin sowie eine "Antikoloniale Demonstration". Außerdem sollen Diskussionsveranstaltungen zu den Verbrechen der Kolonisierung und rassistischer Diskriminierung stattfinden. Zudem möchte die Konferenz auch den antikolonialen Widerstand in Afrika beleuchten. Und die "Anticolonial City Tour" begibt sich auf Spurensuche in der Kolonialmetropole Berlin.
Der Kongress Mitte November soll nicht der Endpunkt der Aktivitäten sein, sondern ein Kulminationspunkt, wie es im Aufruf heißt. Bereits im Vorfeld fanden Veranstaltungen zum Thema Kolonialismus statt, etwa zur Arbeitserziehung, zu Kolonialdenkmälern oder den deutsch-namibischen Beziehungen. Die Hoffnung, dass bundesweit viele Gruppen entstehen, die antikoloniale Aktionen organisieren, hat sich allerdings nicht erfüllt.
Amnesie ist keine Option für Opfer
Auch wird die Konferenz weitaus kleiner ausfallen, als ursprünglich angedacht. Das Programm ist überschaubar (was nicht das Schlechteste ist) und die Podien sind in der Regel mit deutschen ReferentInnen besetzt. Laut Tita Denis, der in der Vorbereitungsgruppe mitarbeitet, mangele es vor allem an Geld, um Gäste aus dem Ausland, etwa JournalistInnen und WissenschaftlerInnen aus den ehemaligen Kolonien, einladen zu können. Nach Ansicht anderer Mitglieder der Vorbereitungsgruppe verliefen aber auch die Vorbereitungen insgesamt sehr langsam. Sie begründen dies mit der engen Kooperation von MigrantInnen und Menschen mit deutschem Pass, bei der Wert darauf gelegt würde, dass sich alle gleichermaßen an der Vorbereitung beteiligen könnten. Dies erfordere oft besondere, aber auch gewünschte Bemühungen von allen Seiten: Auf den Treffen muss in mehrere Sprachen übersetzt werden, vor allem Flüchtlinge sind auf Grund der Residenzpflicht, Geldmangel und ihrer abgelegenen Unterbringung weniger mobil und haben keinen guten Zugang zu Computer und Telefon wie die meisten deutschen AktivistInnen.
Nichtsdestotrotz erwartet Tita Denis für die Konferenz rund 500 TeilnehmerInnen. "Wir möchten die kolonialen Mentalitäten aufbrechen, die in Europa für den Rassismus verantwortlich sind", sagt er. Außerdem soll die Konferenz ein Bewusstsein über die Kolonialgeschichte schaffen und eine Plattform für Austausch und Diskussion bieten, so Tita Denis.
Nicht neokolonial, auch nicht postkolonial nennt sich die Konferenz, sondern antikolonial. Damit soll auf die "Kontinuität der kolonialen Strukturen" hingewiesen werden. "Es gab keinen wirklichen Wandel, die ehemaligen Kolonien sind immer noch politisch und ökonomisch von den westlichen Ländern abhängig", so Tita Denis. Und im Aufruf heißt es: "Der antikoloniale Widerstand ist politisch für uns ein zentraler Orientierungspunkt."
Es ist zu befürchten, dass hier verschiedene historische Ereignisse, polit-ökonomische Entwicklungen und veränderte Funktionsweisen von Herrschaft, Rassismus und Ausbeutung in einem Topf verquirlt werden. Zu hoffen bleibt, dass auch die Brüche, Übergänge und Diskontinuitäten sowie anti-emanzipatorische Aspekte antikolonialer Bewegungen beleuchtet werden und nicht ein simpeles Opfer/Täter-Schema und ein binärer Mythos übrig bleiben, die eine eindimensionale Vorherrschaft eines Zentrums gegenüber der unterdrückten und grundsätzlich unschuldigen Peripherie zeichnen. So wichtig es ist, endlich eine Konferenz zu diesem Thema zu veranstalten, so unabdingbar ist es für eine anti- und postkoloniale Perspektive, Differenz (etwa Subalternität/Hegemonie, Schwarz/Weiß) sichtbar zu machen und zu benennen, ohne unbewegliche Differenzidentitäten zu konstruieren und festzuschreiben. Sonst könnte die Konferenz allenfalls ein Publikum auf das Thema Kolonialismus aufmerksam machen, ohne in der Lage zu sein, die Auseinandersetzung auch zu vertiefen.
Anke Schwarzer
Anticolonial Africa Conference Berlin 11. bis 15. November 2004 in der Alten Feuerwache in Berlin www.africa-anticolonial.org



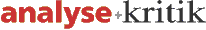 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 488 / 15.10.2004
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 488 / 15.10.2004
