Strategische Verunsicherung
Zu den identitären Fallstricken der Debatte um prekäre Arbeit
Das Normalarbeitsverhältnis steht unter Druck. Gerade die Auseinandersetzungen des letzten Jahres in den industriellen Großbetrieben belegen: Prekäres Leben und Arbeit ist normaler Dauerzustand. Doch in der Prekarisierungsdiskussion ist das noch nicht wirklich angekommen.
Der Slogan von der Prekarität als Normalarbeitsverhältnis des 21. Jahrhunderts ist in der linken Debatte fast zum Allgemeinplatz geworden. Und dennoch wird die Diskussion faktisch als Teilbereichsdiskussion geführt. Egal ob Freelancer oder Mini-Jobberin, ob illegalisierte Hausarbeiterin, (akademische) Projekte-Linke oder Wanderarbeiterin: Unausgesprochen bezieht sich der linke Prekarisierungsdiskurs vornehmlich auf das weite und in der Tat zunehmende Feld von Beschäftigungsverhältnissen, die nach bisherigen Normalitätskriterien ungesichert oder atypisch sind. Trotz aller Einigkeit über sein Ende bleibt dabei aber das "fordistische Normalarbeitsverhältnis" immer noch der Referenzpunkt: Stets steht die Unterscheidung im Raum, die Beschreibung von Teilen der (lohnabhängig) Beschäftigten als Prekäre in Abgrenzung von "normalen" Arbeitsverhältnissen. Dass diese identitär-abgrenzende Betrachtungsweise in weiten Teilen die subjektiven und objektiven Lebensverhältnisse der (radikalen) Linken widerspiegelt, ist dabei kein Zufall.
Schon als die Debatte Anfang der 1990er Jahre das erste Mal aufkam, war sie von Gegenüberstellungen geprägt: reguliert - dereguliert, gesichert - ungesichert, tarifiert - tariflos, garantiert - entgarantiert. Damals wie heute waren und sind solche Gegenüberstellungen analytisch und politisch irreführend. Es ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber in kapitalistischen Gesellschaften hat es niemals so etwas wie Garantien für Arbeit und Existenzsicherung gegeben. Die Existenz- und Reproduktionsbedingungen von Menschen, Familien und Haushalten, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, waren und sind prinzipiell entgarantiert.
Das "fordistische Normalarbeitsverhältnis" war in historischer und globaler Perspektive stets eine Ausnahmeerscheinung. Es war auf die Länder des Nordens begrenzt und dort auch nur auf einen beschränkten historischen Zeitraum. Bereits ein flüchtiger Blick auf so unterschiedliche Staaten wie die USA, Frankreich, Italien oder die skandinavischen Länder zeigt, wie disparat und inhomogen Arbeitsverhältnisse und -realitäten auch in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren waren und wie problematisch ein vereinheitlichender Fordismus-Begriff ist. Und auch in der BRD war das "Normalarbeitsverhältnis" in jenen "goldenen Zeiten" keineswegs allgemeingültig. Für Frauen war Erwerbsarbeit überhaupt nicht vorgesehen, und dort, wo sie in die Lohnarbeit eingebunden waren, haben sie in aller Regel "nur dazuverdient". D.h. Frauen haben schon immer in Leichtlohngruppen und in prekären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Gleiches galt und gilt für ArbeitsmigrantInnen und für Flüchtlinge. Aus der Perspektive des Südens, aus der Perspektive von Frauen und MigrantInnen und in zeitlichen Dimensionen, die nicht etwa auf die 1960er Jahre fixiert sind, erscheint Prekarität als der eigentliche kapitalistische Normalzustand
In den ökonomischen, sozialen und politischen Umbauprozessen der letzten 10-20 Jahre geht es um eine umfassende Neudefinition dessen, was heute als "normale" proletarische Arbeits- und Reproduktionsbedingungen zu gelten hat. Prekarisierungs- und Flexibilisierungsprozesse entfalten ihre soziale Bedeutung also weniger als Charakteristika bestimmter Beschäftigtengruppen, sondern vor allem als verallgemeinerte Normen für alle proletarischen Lebens- und Arbeitsrealitäten. Prekarität meint deswegen auch wesentlich mehr als Verarmung, Niedriglohnsektoren und Teilsegmente des Arbeitsmarktes. Prekarität ist vielmehr die prinzipielle und fundamentale Verunsicherung aller Lebens- und Arbeitsbereiche. Für immer mehr Menschen wird die Zukunft und die Existenzsicherung unter Vorbehalt gestellt: Gibt es einen Folgeauftrag? Wird mein Vertrag verlängert? Wird das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld gestrichen? Wird der Betrieb geschlossen oder verlagert? Werde ich übernommen? Lande ich bei Hartz IV? Reicht das Geld - für den Urlaub, für die Ausbildung der Kinder, fürs nackte Überleben? Was passiert, wenn ich krank oder alt bin? Wenn ich ein Pflegefall werde oder jemand aus der Verwandtschaft?
Eins ist sicher: die Unsicherheit
Diese Verunsicherung ist Programm, sie ist die eigentliche Botschaft der Agenda 2010. Wie ein roter Faden durchzieht die Strategie der Verunsicherung den Umbau der sozialen Sicherungssysteme, die Repression gegenüber Erwerbslosen, die Mobilisierung von Arbeit in Niedriglohnbereichen und die Angriffe auf die tarifierten Arbeitsverhältnisse. Und was sich auf der Ebene der öffentlichen Verlautbarungen als eine permanente Abfolge neuer Drohszenarien, Rücknahmen und neuer Ankündigungen darstellt, ist nicht nur Ausdruck eines fehlenden hegemonialen Herrschaftsprojekts. Als Signal einer andauernden Instabilität ist eine solche öffentliche Darstellung auch Teil eines bewussten Verunsicherungsprogramms. Wenn es mit der Agenda 2010 darum geht, die Verwertungsbedingungen für das Kapital am "Standort Deutschland" zu verbessern, so liegt der eigentliche Inhalt dieses Programms genau hier, in der materiellen und subjektiven Destabilisierung der sozialen Reproduktion. Das heißt nicht, dass auf Regulierungsformen und -instanzen wie Tarife, Sozialstaatlichkeit und Gewerkschaften verzichtet würde. Aber die Regulierung der Agenda 2010 verabschiedet sich definit von sozialen Existenzgarantien. Es geht darum, soziale Sicherheitsbedürfnisse nachhaltig als "Vollkaskomentalität" zu diskreditieren und durch permanente und lebenslange Flexibilisierungsanforderungen zu ersetzen.
Wenn irgend etwas das umfassende politische Herrschaftsprojekt der Prekarität augenfällig symbolisiert hat, dann war es die Gleichzeitigkeit des sozialen Angriffs im letzten Jahr: Hartz IV mit staatlicher Zwangsflexibilisierung und Zwangsprekarisierung auf der einen Seite und die nahezu geschlossenen Attacken des Kapitals auf die (groß-)industriellen Beschäftigungsverhältnisse auf der anderen. Die Tarifverträge und Standortsicherungsvereinbarungen bei Siemens, DaimlerChrysler, Opel, Karstadt/Quelle, VW usw. folgen alle einem Muster: länger und härter arbeiten, weniger Geld und - vor allem - hochoffizielle Aufkündigung einer Beschäftigungs"garantie". Der so genannte "Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen" bis zum Jahre X sagt ja vor allem eines, nämlich dass alle Arbeitsplätze in den nächsten Jahren neu zur Disposition stehen. Wenn man so will, handelt es sich um eine grundsätzliche Befristung von Arbeitsverhältnissen. (1) Das Jahr 2004 hat schlagend demonstriert, dass die prekäre (Tarif-)Wirklichkeit kleinerer und mittlerer Betriebe flächendeckend und Branchen übergreifend die Norm auch in den industriellen Kernbereichen geworden ist. Prekarität ist inzwischen längst in der Mitte des Arbeitsmarktes angekommen.
Ein Blick auf die real existierende Arbeit belegt zweierlei: zum einen die umfassende Entgarantierung und damit die Normalität der Prekarität; der alte Blickwinkel von den fein säuberlich trennbaren Kern- und Randbelegschaften wird genauso obsolet wie die Vorstellung, es gäbe einen klar abgrenzbaren Niedriglohnsektor:
- Schon seit Jahren sind industrielle Großbetriebe in hohem Maße "porös". Auf dem Werksgelände von Opel in Bochum bewegen sich ArbeiterInnen und Angestellte von 50 und mehr Firmen. Sie gehören zu Zulieferern, Leiharbeitsfirmen oder zu ausgegründeten Betriebsteilen des Konzerns selbst. In einer Halle arbeiten somit unzählige Beschäftigte zu völlig unterschiedlichen Konditionen nebeneinander, manchmal machen sie sogar dieselbe Arbeit - allerdings unter komplett unterschiedlichen Tarif- und Entlohnungsbedingungen. Diese Patchworkrealität spiegelt sich nicht zuletzt auch in den inzwischen unzähligen Tariföffnungsklauseln und Sondertarifen für BerufsanfängerInnen, NeueinsteigerInnen oder ausgegründete Betriebsteile. (2)
- Selbst dort, wo Arbeitsbedingungen tariflich reguliert sind, sind sie alles andere als sicher und immer öfter auch nicht Existenz sichernd. Von 2.800 Tarifverträgen in Deutschland beinhalten 130 Stundenentgelte von sechs Euro und weniger. Das neue Tarifwerk im Öffentlichen Dienst führt explizit einen Niedriglohnsektor ein, die früher mal weggekämpften Leichtlohngruppen feiern fröhliche Wiederkehr.
- Über ein Drittel aller Vollzeitbeschäftigten arbeiten in Deutschland zu Niedriglöhnen, häufig genug tarifiert. Da sind die "klassischen" prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit etc. noch gar nicht enthalten.
Prekarisierungs-
debatte in der Sackgasse?
Zur Realität der heutigen Normalarbeit gehören natürlich auch die sechs Millionen MinijobberInnen, zu über 70% Frauen, die diversen Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung, 1-Euro-Zwangsdienste und nicht zuletzt die Pflichtarbeit in den Gefängnissen oder die Arbeit in den Werkstätten für Behinderte. Spätestens bei diesen Beispielen und erst recht dann, wenn Aspekte der geschlechtshierarchischen oder rassistischen Zuweisungen am Arbeitsmarkt berücksichtigt werden, zeigt sich der zweite Aspekt der Prekarität. Hinter diesem Begriff verbergen sich nämlich erhebliche soziale Hierarchien und Spaltungslinien. Sowohl in den objektiven Rahmenbedingungen wie auch in der subjektiven Wahrnehmung und damit in den Verhaltensweisen liegen gravierende Unterschiede. Das Leben am seidenen Faden führt noch lange nicht und erst recht nicht automatisch zu einem gemeinsamen Widerstandsverhalten. Auch das hat das letzte Jahr gezeigt, in dem es kaum eine gegenseitige Bezugnahme etwa zwischen Montagsdemos, den Streiks bei Daimler und Opel oder den linken Bewegungsversuchen zwischen Prekarisierung und Agenturschluss gegeben hat.
Prekarität ist ein anderer Begriff dafür, dass in ungeheurem Umfang Arbeit neu mobilisiert wird. Weit davon entfernt, in der Krise zu sein, feiert "die Arbeitsgesellschaft" in Gestalt des "Terrors der Ökonomie" (Vivianne Forrester) fröhliche Urständ. Prekarität beschreibt damit aber auch, dass die proletarische Existenz in allen ihren Segmenten eingekreist und angegriffen wird. Es ist zwar richtig, dass es eine "Prekarisierung von unten" gegeben hat und gibt, eine Flucht aus und vor den Zwängen des Betriebs- und Büroalltags oder den Verfolgungen durch Arbeits- und Sozialämter. Doch weder existieren diese kleinen Fluchten und Nischen jenseits der (Selbst-)Verwertungslogik, noch können sie darüber hinwegtäuschen, dass die selbst gewählte prekäre Existenz nur für wenige eine lebbare Perspektive bedeutet. Der linke Prekarisierungsdiskurs muss vor diesem Hintergrund aufpassen, dass er nicht in eine Sackgasse läuft. Es sollte zu denken geben, dass zwar die Kämpfe und Selbstorganisationsformen "der Prekären" beschworen werden und ihr Fehlen oft genug beklagt wird, gleichzeitig aber auf die Kämpfe gegen den Prekarisierungsangriff etwa bei Daimler oder Opel kaum Bezug genommen wird. Doch gerade im Zusammenhang mit der Neudefinition von "Normalarbeit" als umkämpftem Prozess sind diese Kämpfe alles andere als marginale und nostalgische Abwehrkämpfe. In dem Maße, wie es bewusst oder unbewusst in der linken Prekaritätsdiskussion um die Einteilung, Definition und Abgrenzung bestimmter Klassensegmente geht, deutet einiges darauf hin, dass der Prekaritätsbegriff an seine Grenze gestoßen ist.
Dirk Hauer
Anmerkungen:
1) Mal abgesehen davon, dass natürlich auch ohne betriebsbedingte Kündigungen kräftig entlassen wird.
2) Es ist erst gut zehn Jahre her, dass die IG Chemie in der Tarifrunde 1994 den ersten Sondertarif für BerufseinsteigerInnen unterzeichnet hatte; inzwischen sind solche Regelungen gang und gäbe.



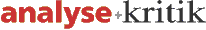 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 494 / 15.4.2005
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 494 / 15.4.2005
