Gegen Militarisierung und Sozialdumping
Das französische Nein zur EU-Verfassung hat gute Gründe
Nach der Ablehnung der EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden herrscht Ratlosigkeit bei den europäischen Strategen. Tony Blair, der am 1. Juli die EU-Präsidentschaft übernimmt, hat das britische Referendum auf unbestimmte Zeit verschoben und schwadroniert von einem "neuen europäischen Sozialmodell". Kommissionspräsident José Manuel Barroso befürchtet derweil eine vor allem von Frankreich ausgehende "Ansteckungsgefahr". Was in solchen Formulierungen als Krankheit oder gar Seuche erscheint, war in Wahrheit ein berechtigter Protest gegen Militarisierung und Sozialdumping.
Hinterher wollte man die klare Niederlage immer noch nicht wahrhaben. Eine satte Mehrheit von 55 Prozent der französischen StimmbürgerInnen hatte beim Referendum am 29. Mai den "Verfassung" genannten EU-Staatsvertrag abgelehnt. Für diesen Vertrag hatten die französischen und mehr noch die deutschen Medien massiv Werbung gemacht.
Die einzige überregionale Tageszeitung, die gegen das Vertragswerk Partei ergriffen hatte, war die KP-Tageszeitung L'Humanité (Auflage rund 60.000). Ansonsten warben fast alle Presseorgane und erst recht das Fernsehen auf mitunter äußerst tendenziöse Weise für die Annahme des Vertrages. Nur ein Beispiel: Die linksliberale Pariser Abendzeitung Le Monde brachte am 25. Mai, vier Tage vor der Abstimmung, als Aufmacher einen angeblichen "Aufruf der europäischen Gewerkschaften für das Ja". Im Blattinneren fand sich aber lediglich ein Interview mit drei führenden italienischen Gewerkschaftsfunktionären über die vermeintlichen Vorzüge (und, verhaltener, auch über Nachteile) des Vertragswerks. In einem redaktionell zusammengefassten Gespräch erklärte auch der Ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, er "persönlich" würde mit Ja stimmen. Unterdessen neigten fast alle französischen Gewerkschaften, mit Ausnahme der rechtssozialdemokratischen CFDT, zur klaren Ablehnung des Verfassungsvertrags. Am folgenden Tag behauptete Le Monde, "über 50 Prozent" der voraussichtlichen Nein-Stimmen kämen von der extremen Rechten. Das passte in das Strickmuster vor allem der sozialdemokratischen Parteiführung, die alle Kritiken von links systematisch in den Topf des "Rechtspopulismus" zu stecken versuchte. Das konnte jedoch schon rein mathematisch nicht stimmen. Denn die extreme Rechte käme derzeit auf rund 9 Prozent der Stimmen (das wäre ein Prozent weniger als bei den EU-Parlamentswahlen 2004) und steckt darüber hinaus in einer schweren Krise, die mit der ungeklärten Nachfolge ihres alternden Übervaters Jean-Marie Le Pen zusammen hängt. Wie 9 Prozent "mehr als die Hälfte" von 55 Prozent Nein-Stimmen ergeben sollten, blieb das Geheimnis der Redaktion. Später bedauerte der Ombudsmann der Redaktion, Robert Solé, der sich um die Beziehungen zu den LeserInnen kümmert, den "groben Fehler" - aber erst am 4. Juni, eine knappe Woche nach der Abstimmung.
Schlechte Verlierer
Schenkt man denselben Medien jetzt Glauben, dann wurde der EU-Verfassungsvertrag durch die französischen WählerInnen überhaupt nicht abgelehnt. Nein, er wurde nur zum Opfer eines Missverständnisses zwischen dem Wahlvolk und den ungeschickten Eliten, die ihn nicht richtig zu erklären vermochten. Oder er geriet zufällig zwischen die Fronten, als ganz andere Rechnungen beglichen wurden. Denn angeblich nutzte die Mehrheit das Referendum nur dazu, Chirac und Co. einen Denkzettel zu verpassen. "Die Unbeliebtheit der nationalen Politiker", so erfährt man allenthalben, habe die Annahme der schönen "europäischen Verfassung" vermasselt. Mit deren Inhalt hätte das NON zu dem Staatsvertrag also überhaupt nichts zu tun gehabt. So glaubt die Frankfurter Rundschau am "Tag danach" zu wissen, "dass die Franzosen ihre politische Klasse bis oben satt haben (...) und deshalb jetzt Europa für dieses Versagen büßt". Auch einer der führenden französischen Vertreter der "Gauche caviar" (Schicki-Micki-Linken), Jack Lang, der frühere Kulturminister am Hofe François Mitterrands, bestritt gegenüber einer britischen Journalistin, dass die Verfechter des Verfassungsvertrags auch nur entfernt so etwas wie eine Niederlage erlitten hätten: "Allein Chirac hat ordentlich was auf die Zähne bekommen!" An anderem Ort (im Interview mit Libération) hatte Lang es kurz zuvor als "moralische Pflicht" der französischen SozialistInnen bezeichnet, das Vertragswerk zu verteidigen.
Mit der Wirklichkeit hat diese Darstellung wenig zu tun. Zwar stimmt es, dass das NON auch den Präsidenten treffen sollte, der das Referendum angesetzt hatte und noch vor Monaten davon träumte, es werde zu einem Plebiszit zu Gunsten seiner Person werden - womit er gehörig auf die Nase fiel. Hätte die Frage gelautet, ob Chirac zurücktreten solle, dann hätte die Zustimmung bei rund 80 Prozent gelegen. Aber das war eben nicht alles: Die Französinnen und Franzosen haben auch über den Text selbst abgestimmt. Und am Ende haben viele ihn sogar gelesen, obwohl das 448 Artikel, 20 Zusatzprotokolle und noch mehr umfassende Vertragswerk eine äußerst undankbare Lektüre darstellt.
Noch anderthalb Monate vor der Abstimmung sah es denn auch so aus, als ob nur eine verschwindend kleine Minderheit den Text studiert hätte. Doch dann kam der Umschwung: 12 Prozent gaben am Ende an, den Text ganz oder großteils gelesen zu haben, 46 Prozent haben sich zumindest in Auszügen mit dem Vertrag vertraut gemacht. Dazu hatten vor allem die Opponenten Material bereit gestellt. Die Flugblätter von Gewerkschaften, radikalen Linken oder auch von attac waren gespickt mit Verweisen auf konkrete Paragrafen, die zur kritischen Lektüre empfohlen wurden. Dabei ging es vor allem um die wirtschafts- und sozialpolitischen Bestimmungen des Vertrags, der die neoliberale Linie als zukünftig einzig legitime, da "verfassungsmäßige" Politik auf Dauer festschreiben wollte. Kritisiert wurde auch der "Militarisierungsartikel" I-41, der alle Mitgliedsländer zur "Verbesserung ihrer Verteidigungskapazitäten" und Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben verpflichten sollte.
Links liest, Rechts lügt
Dagegen fand sich in den Hochglanz-Faltblättern der Mehrheitssozialdemokratie (die Partei war in dieser Frage gespalten, im übrigen stimmten fast 60 Prozent ihrer WählerInnen mit NON), der konservativen Regierungspartei UMP oder der christdemokratischen UDF, in denen für die Annahme des Vertrages geworben wurde, auffälligerweise keinen einzigen Verweis auf den Vertragstext. Die BefürworterInnen forderten denn auch dazu auf, sich nicht zum konkreten Wortlaut der Verfassung zu positionieren, sondern "zur europäischen Idee". Nach ihrer Darstellung wurde über "Europa ja oder nein" abgestimmt und nicht über reale Vertragsbestimmungen. Den Sozialdemokraten zufolge ging es um ein "sozialeres und freieres Europa" - aus Sicht der UMP dagegen vor allem um ein "mächtigeres und unabhängiges Europa". So führte die UMP in ihrem Fernsehspot Raketen und Militärgerät vor, wobei eine metallene Stimme im Hintergrund rief: "Ich will ein stärkeres Europa". Ein ähnliches Motiv wurde auch in den Umfragen angeboten: "Europa soll sich neben den Großmächten USA, China und Indien behaupten", was zumindest die Logik des Wirtschaftskrieges beinhaltete; diese Position wurde im übrigen von 52 Prozent derer, die mit Ja stimmten, als hauptsächliches Motiv benannt.
Ansonsten ging es vor allem den KritikerInnen überwiegend um die gesellschaftspolitischen Ziele der Union. Die Zielsetzung des Verfassungsvertrags besteht darin, die Sozialpolitik, die Regelung der Arbeitsbedingungen usw. weiterhin den Nationalstaaten zu überlassen - Artikel III-210-2 schließt explizit eine Angleichung der nationalen Gesetzgebungen auf diesem Gebiet aus - und über diese einzelstaatlichen "Schutzräume" einen transnationalen Markt zu spannen. Auf diesem Markt soll die "freie und unverfälschte Konkurrenz" herrschen (der Ausdruck taucht insgesamt 174 mal auf), das Kapital soll vollkommene Niederlassungsfreiheit genießen (Art. III-137), und vor allem die Dienstleistungen sollen zunehmend "liberalisiert" und privatisiert werden (Art. III-145 ff.). Damit würden die Grundlagen für eine mörderische Standortkonkurrenz und ein europaweites Sozialdumping gelegt. Dagegen forderten die linken KritikerInnen die "Angleichung der demokratischen und sozialen Mindeststandards nach oben".
Von rechts, und im Falle der extremen Rechten nahezu ausschließlich, wurde statt dessen ein anderes Thema bemüht, das am 29. Mai gar nicht zur Abstimmung stand: einen zukünftigen EU-Beitritt der Türkei. An diesem Punkt verliefen die Fronten jedoch quer zu den OUI- und NON-Lagern: Gegen die Türkei, die als armes oder als moslemisches Land "nichts in Europa zu suchen" habe, hetzten nämlich sowohl die Vertragsgegner von rechts als auch viele seiner konservativen Befürworter. Die christdemokratische UDF etwa versuchte im Wahlkampf, die Vorzüge des Verfassungsvertrags am Beispiel des Draußenhaltens der Türkei zu demonstrieren. Das im Text vorgesehene "Petitionsrecht" garantiere nämlich, dass das Land nicht aufgenommen werden könne, wenn nur eine Million EU-BürgerInnen dagegen unterschrieben. Das war eine glatte Lüge: Der Artikel I-47-4 des Vertragswerks garantiert nämlich allein das Recht, die Kommission (EU-Exekutive) "einzuladen", sich nochmals mit diesem oder jenem Thema zu befassen. Ob und was diese dann entscheidet, bleibt allein ihr überlassen. Es bleibt also bei dem Recht, mit 999.999 anderen UnionsbürgerInnen zusammen ein Briefchen zu verfassen. Dagegen musste diese Argumentation der rechten Vertragsbefürworter die Vorstellung untermauern, der - bisher virtuelle - türkische Beitritt zur EU stelle wirklich ein zentrales Problem dar.
Hingegen traten die meisten der linken VerfechterInnen des NON explizit dafür ein, dass die Türkei - falls ihre Bevölkerung dies mehrheitlich wünsche - das Recht habe, der EU beizutreten. Zur Voraussetzung wollten die KP, die LCR und die Linksgrünen dabei nicht wirtschaftspolitische Auflagen machen, wohl aber ein effektives Folterverbot und die Anerkennung des Genozids an den Armeniern, im Sinne "demokratischer statt ökonomischer Konvergenzkriterien".
Neue Regierung, alte Politik
Wichtig wird nunmehr vor allem sein, wer in naher Zukunft welche Initiativen ergreift. Die Lehre, die die kommende EU-Ratspräsidentschaft unter Tony Blair aus dem "doppelten Nein in Frankreich und den Niederlanden" ziehen wird, ist klar: Eine EU als vergrößerter Markt ohne weitgehende politische Integration, in der die Nationalstaaten überwiegend nur ökonomische Beziehungen unterhalten, tut es auch. Der Neoliberalismus kann somit auch die neu entstandene Situation sehr gut für sich nutzen. Worauf es ankommt, ist, ob auch grenzüberschreitende soziale Widerstände aufkommen werden, damit eine andere Lehre aus dem französischen NON erwachsen kann. Etwas besseres als die Nation und den Markt gibt es allemal.
In Frankreich hat das Referendum zu einer Regierungsumbildung geführt. Neuer Premierminister ist Dominique de Villepin, der sieben Jahre lang Chiracs Präsidialamt leitete, bevor er 2002 Außen-, später Innenminister wurde. Unter ihm wird auch weiterhin der neoliberale "Reformkurs" mit einem vordergründigen Bekenntnis "zur Bewahrung des französischen Sozialmodells" verkoppelt werden, das man - nach den Worten Chiracs vor dem Ansturm eines "anglo-amerikanischen Modells" schützen wolle. Vor der Demontage sozialer Errungenschaften schützt das bekanntlich nicht.
Nicolas Sarkozy, die "Nummer zwei" der Regierung, alt-neuer Innenminister und starker Mann im Hintergrund, schätzt diese Doppelbödigkeit nicht. Er hatte im jüngsten Abstimmungskampf offen getönt: "Wir benötigen Europa, um Frankreich zu verändern". Nach dem Vorbild des "erfolgreichen britischen Modells" müssten endlich noch mehr prekäre Arbeitsverhältnisse, noch mehr Flexibilität und Arbeitszwang für die Erwerbslosen her. Sein Kalkül: Der Sieg des NON, zugleich eine schwere Niederlage Chiracs, könnte diesem eine Bewerbung um eine dritte Amtsperiode ab 2007 unmöglich machen. Damit wären die Grundlagen für eine rechte Kampfkandidatur mit Sarkozy gelegt. Darauf scheinen die Dinge nun hinauszulaufen.
Bernhard Schmid,
Paris



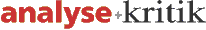 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 496 / 17.6.2005
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis
/ Nr. 496 / 17.6.2005
